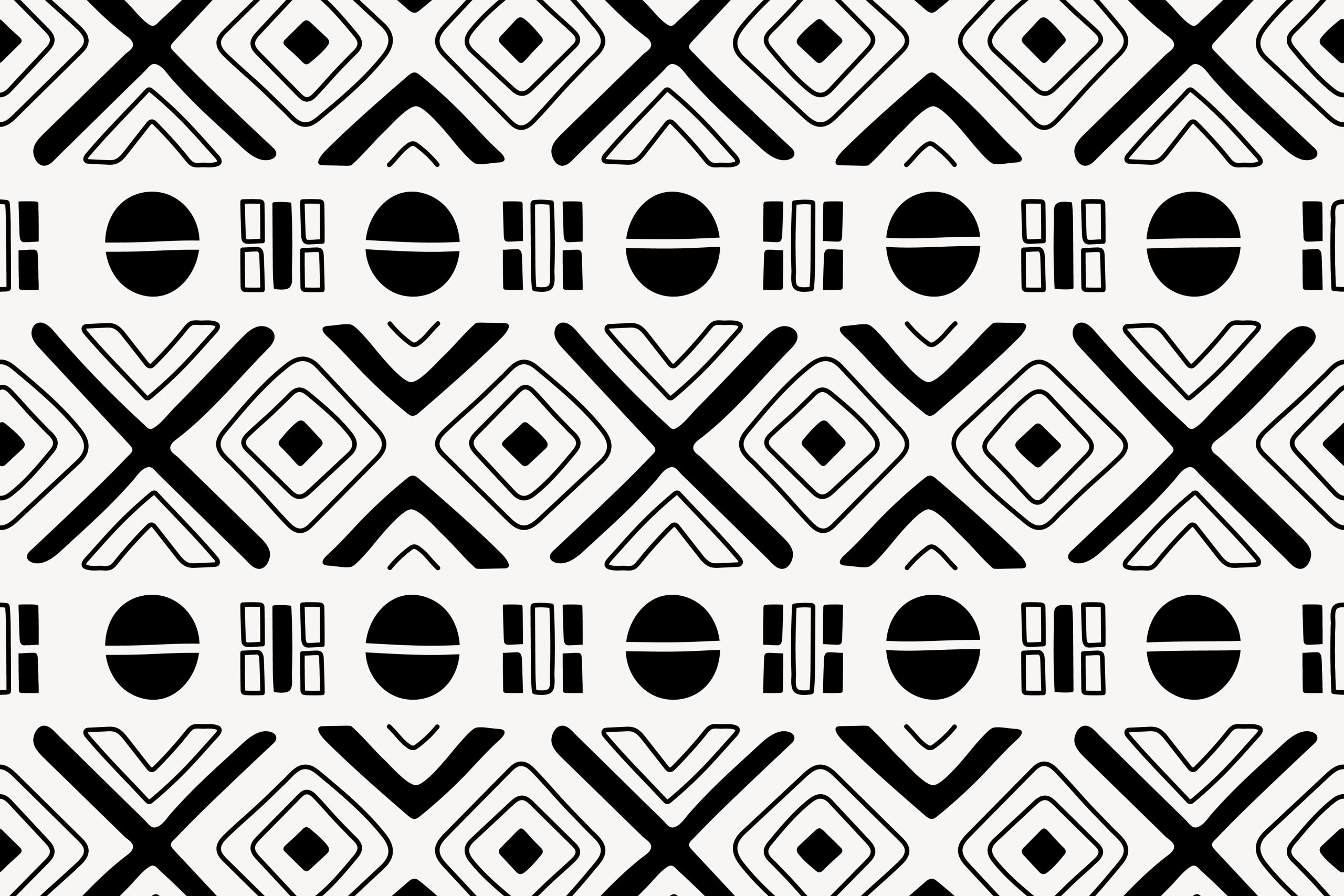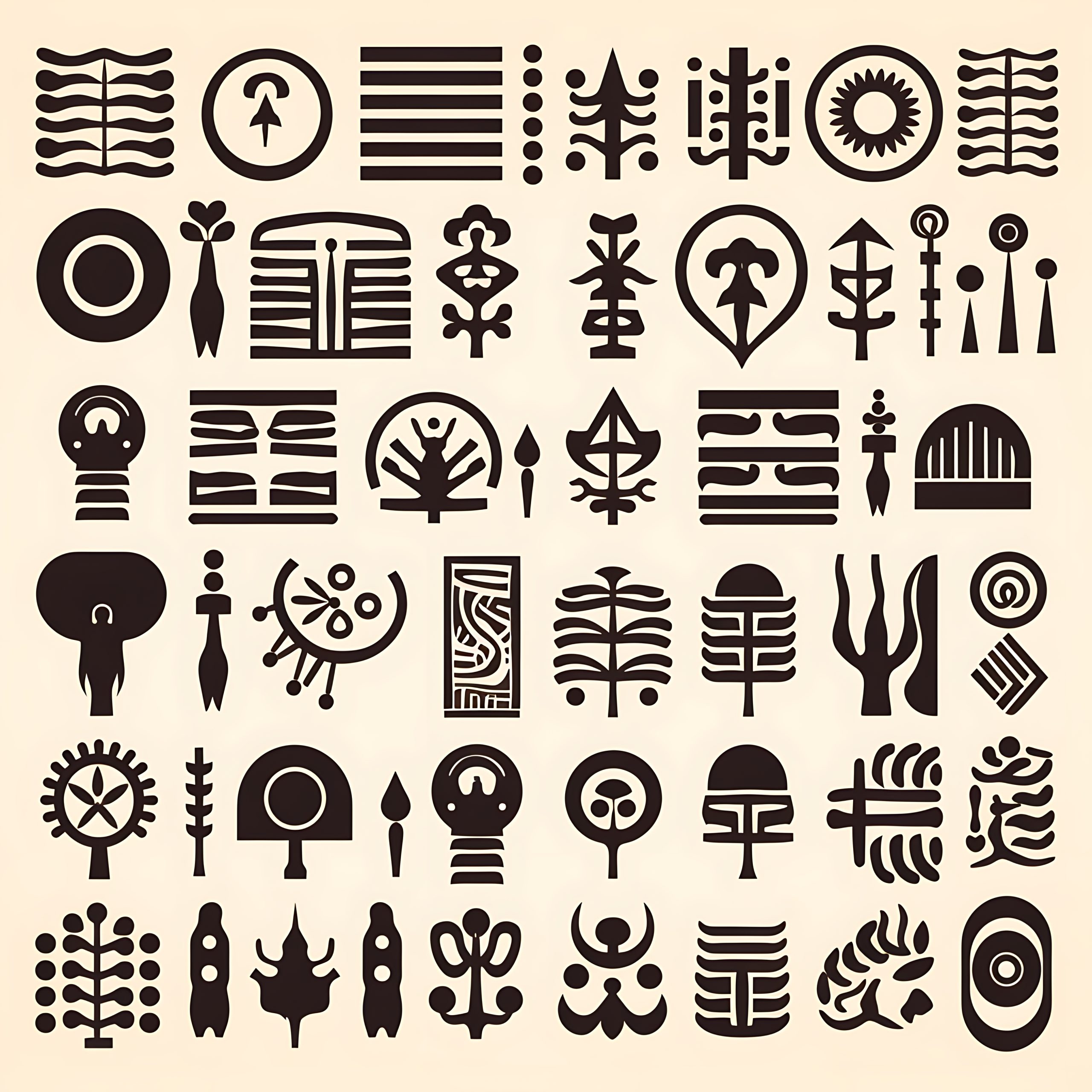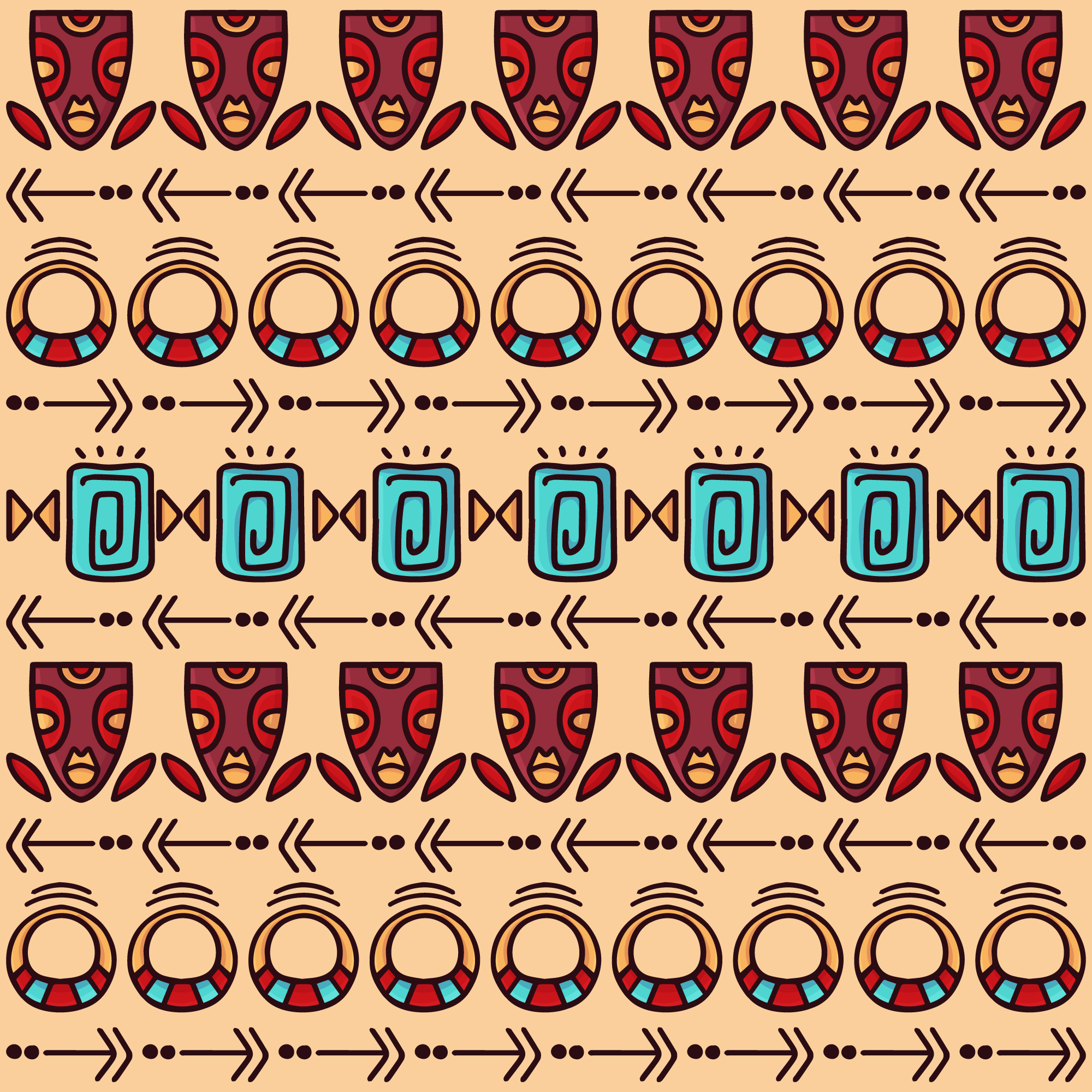‘Too cool for rules’ oder das neue Miteinander.
Der moderne Mensch hat sich freigeschwommen – raus aus dem Korsett von Anstand, Manieren und sozialer Rücksichtnahme. Was früher als gutes Benehmen galt, ist heute bestenfalls altmodisch, schlimmstenfalls reaktionär. Wer heute im Zug das Telefon zückt, spricht nicht mehr diskret – nein, er inszeniert. Jede Haltestelle wird zur Bühne, jeder Waggon zur Arena des akustischen Exhibitionismus. Denn wer schweigt, existiert offenbar nicht.
Der zeitgenössische ‘Homo digitalis’ ist ein Performer. Er trägt seine Stimme wie eine Fahne vor sich her, und sein Alltag gleicht einer Dauerperformance vor unsichtbarem Publikum. Rücksicht ist zu einem nostalgischen Konzept verkommen, Manieren zu einem Museumsstück. Es geht nicht mehr einfach um Kommunikation, sondern um starke Präsenz – um spürbare Sichtbarkeit, Lautstärke und schiere Dominanz. Die Öffnung des Raums bedeutet nicht mehr stille Teilhabe, sondern freche Besitzergreifung. Wer spricht, markiert sein Revier, wer laut ist, gewinnt das Terrain. Die anderen sollen das Maul halten.
Früher galt Zurückhaltung als Zeichen von Lebensreife – heute wird sie als dumme Schwäche ausgelegt. Der öffentliche Raum, einst Ort des Miteinanders, ist zum Resonanzraum für Egomanie mutiert. Gespräche finden nicht mehr zwischen zwei Menschen statt, sondern im Monolog mit der Welt – Hauptsache, es hört jemand zu. Selbst dann, wenn es nur die heisse Luft ist. Es zählt nicht, was gesagt wird, sondern dass überhaupt gesprochen wird. Der Mensch redet, also ist er. Doch wer zuhört, wer schweigt, wer Raum lässt – der wird überhört, übersehen, überrollt und platt gemacht.
Wenn der Lautsprecher lauter ist als der Anstand
Was früher ein kurzes, zischendes ‘Psssst!’ und einen tadelnden Blick provozierte, ist heute der schnellste Weg, als Spassbremse, Kulturpessimist oder gar als aggressiver, aus der Zeit gefallenen Regelwächter abgestempelt zu werden. Der öffentliche Raum ist zur Bühne der Egomanen geworden. Die Welt ist ein grosser, offener Chatroom – ohne Logout-Button, ohne Filter. Die Gesprächspartner? Wahlweise real, virtuell oder irgendwo dazwischen. Alles zwischen Himmel und Erde. Oder vielleicht Hölle. Und wer nicht mithört, wird mit lockerer Nonchalance zwangsbeglückt. Privatsphäre war gestern. Das ist altmodisch. Heute gilt: Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts dagegen, dass alle mithören – und wer etwas dagegen hat, gilt als unzeitgemäss.
Besonders beliebt heute: Extensive Videotelefonie mit Lautsprecherfunktion. Warum auch nur eine einzige Person mit belanglosen Infos belästigen, wenn man gleich einen ganzen Wagon, ein Wartezimmer oder ein Café teilhaben lassen kann und beschallen darf? Wer heute ‘Hallo, hörst du mich?’ sagt, meint eigentlich: ‘Hallo Welt, schaut her, ich bin wichtig und hört einfach mit.’ Die grosszügige Lautstärke ersetzt den Inhalt, das Schallvolumen die Relevanz. Rücksicht? Fehlanzeige. Es geht nicht mehr um den Dialog, sondern um Selbstvermarktung in Echtzeit – um die demonstrative Präsenz im Alltag anderer. Ich bin wichtig. Was kümmert mich das Geschwätz der anderen?
Das soziale Miteinander ist durch eine neue, ungeschriebene Hierarchie ersetzt worden: Wer lauter ist, hat recht. Wer stört, setzt sich durch. Wer sich gestört fühlt, hat Pech gehabt. Die ehemals stillen Zonen des Alltags – der Zug, das Wartezimmer, der Lift, die Sauna, die Bibliothek, der Stadtpark – verkommen zu akustischen Sperrzonen. Und während sich der Anstand langsam aus der Öffentlichkeit zurückzieht, übernimmt der Lautsprecher das Kommando. Der Ton macht nicht mehr die Musik – er macht die Macht. In voller Härte.
Frühstücksbuffet in Badeschlappen – Haute Couture war gestern
Der modische Verfall feiert Urstände – und zwar in aller Öffentlichkeit. Hemmungslos. Wo früher dezente Eleganz und ein gewisser Sinn für Stil zum guten Ton gehörten, dominiert heute der Dresscode der maximalen schrillen Bequemlichkeit. Hotels, einst Oasen gepflegter Erscheinung, sind zum Tummelplatz des Freizeit-Looks mutiert. Jogginghose trifft auf fünf Sterne, Crocs profanisieren den Marmorboden. Der Weg vom Zimmer zum Buffet ist offenbar zu beschwerlich, um auch nur einen Hauch von Würde mitzunehmen. Es gilt die neue Devise: Ich zahle, also darf ich alles. Stil ist keine Frage des Geschmacks mehr – sondern des Widerstands gegen jedes Minimum an Anstand. Manieren für was? Knigge schon lange tot.
Die einstige Etikette des Hauses? Abgeschafft. Der Morgenmantel wird zur Uniform der Dekadenz, die Badeschlappen zum Symbol des modischen Aufstands. Wer im Bademantel das Rührei holt, fühlt sich nicht etwa peinlich berührt – sondern im Recht. Schliesslich wurde bezahlt. Ob das Buffet danach aussieht wie ein Schlachtfeld am Brunch-Frontabschnitt? Nebensache. Hauptsache bequem. Hauptsache ungefiltert. Hauptsache ‘ICH und nochmals ICH’. Der Frühstücksraum verkommt zum Laufsteg der Nachlässigkeit, die Essensausgabe zum Catwalk des gepflegten Desinteresses am Gegenüber.
Doch hinter dem modischen Laissez-faire versteckt sich mehr als nur ein Hang zur Bequemlichkeit: Es ist der Ausdruck eines gesellschaftlichen Phänomens. Die Vorstellung, dass Geld nicht nur Türen öffnet, sondern Regeln ausser Kraft setzt. Dass Dienstleistung gleich Selbstaufgabe bedeutet – auf Seiten des Personals, versteht sich. Wer zahlt, diktiert. Wer konsumiert, bestimmt die Norm. Und wenn diese Norm barfuss, krümelnd und grusslos am Buffet steht, dann ist das eben der neue Stil. Basta. Einwände?
Das private Drama, öffentlich performt
Privatsphäre? Ein Konzept aus Grossmutters Zeiten – vergilbt, verstaubt, überholt. Was früher hinter verschlossenen Türen diskret stattfand, wird heute auf Lautsprecher übertragen, in Insta-Stories in alle Einzelheiten zerlegt oder mindestens live auf Tiktok mit Hingabe und Prolo-Gekrächze zelebriert. Das Leben ist zur Dauer-Show mutiert, die Öffentlichkeit zur Kulisse des eigenen Ego-Festivals. Die intime Diagnose vom Proktologen? Scheiss drauf. Bitte mit Publikum. Denn was wäre ein medizinischer Befund ohne dramatische Kommentare der Bekloppten? Der melodramatische Beziehungsstatus der Cousine dritten Grades? Natürlich ins Tram damit – zwischen Türöffnung und Billettkontrolle. Jeder Moment will geteilt, kommentiert, bewertet werden. Und wer das nicht versteht, lebt offensichtlich im falschen Jahrzehnt.
Selbst beim Coiffeurtermin wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Der Haarschnitt? Ein Statement. Der Smalltalk mit der Stylistin? Sofort Content. Die Reaktion auf der Party? Potenziell viral. Jede noch so triviale Alltagsszene wird zum Ereignis hochstilisiert, jede Emotion auf Bühnenlicht gedreht. Wer sich dabei noch für irgendetwas geniert, hat schlicht die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Scham ist die neue Schwäche, Diskretion ein Armutszeugnis. Wer weiss noch wie man dieses Wort korrekt schreibt? Wer sich beschwert, ist ‘bünzlig’ (spiessig), altmodisch und hinter dem Mond. Wer nicht teilt, ist verdächtig oder tot. Und wer sich noch traut, zu flüstern, hat offensichtlich keine Reichweite. Clickbait ist die neue Währung.
Wir leben im Zeitalter der Selbstenthüllung, des Dauer-Mikrofons. Die Grenze zwischen ‘mein Leben’ und ‘öffentliches Interesse’ ist längst pulverisiert und auf Nanostufe. Nicht das, was gesagt wird, ist entscheidend – sondern dass es überhaupt gesagt wird. In Echtzeit, mit Hashtags, mit passender Musik unterlegt. Die Realität wird nicht mehr gelebt, sondern leidenschaftlich kuratiert und in die Welt getragen. Wer auf ‘Record’ drückt, ist relevant und das Gestirn, um das sich alles dreht. Und wer aussteigt, ist raus. Willkommen im Theater des Alltags, in dem jeder Protagonist oder Protagonistin ist – und keiner mehr Zuschauer sein will.
Kinder, die nicht spielen, sondern piepen
Auch die Jüngsten werden inzwischen effizient und gezielt digital sediert – mit dem Handy. Bewegungsdrang? Nervig. Interaktion? Unberechenbar. Neugier, Lautstärke, unkontrolliertes Fragenstellen? Zu anstrengend für den hektischen Alltag der Erwachsenen. Also lieber ein elektronischer Schnuller in die kleinen Hände gedrückt – bunt, blinkend, algorithmisch dosiert. Pädagogisch zwar fragwürdig, aber immerhin bleibt es ruhig am Tisch, im Wartezimmer, im Restaurant, im Einkaufsgeschäft oder sogar im Fitnessstudio. Die Stille wird erkauft mit Bildschirmzeit, das kindliche Entdecken ersetzt durch endloses Scrollen. Und während Mama noch den überteuerten Cappuccino umrührt und Papa die Spammails checkt, lernt der Nachwuchs früh: Aufmerksamkeit ist ein absoluter Luxus wie Seltene Erde, der delegiert werden kann – an die nächste App. Hauptsache ruhig!
Die Spielplätze bleiben leer, die Fantasie verkümmert, das kindliche ‘Warum?’ wird durch Wischen und Tippen ersetzt. Spielen heisst heute: reagieren statt agieren, konsumieren statt kreieren. Der Wald wird keck gegen YouTube, TikTok und Instagram eingetauscht, das Abenteuer gegen Animation. Hauptsache, niemand stört. Hauptsache, niemand schreit. Hauptsache, niemand lebt sich aus. Und wenn das Kind dann doch mal wieder Kind sein will – toben, brüllen, raufen, stinken, weinen, wütend – wirkt das wie ein septischer Anachronismus aus einer vergangenen Epoche.
Ob das später zu Konzentrationsstörungen führt? Das muss dann halt die Schulpsychologin ausbaden. Oder der Kinderarzt verschreibt über Jahre Ritalin. Oder der überforderte Lehrer, der sich fragt, warum die Klasse sich keine zehn Minuten fokussieren kann. Oder der HR-Verantwortliche, der rätselt, warum die neue Generation bei jeder Push-Nachricht vom Stuhl fällt, der bei Rückmeldungen in Echtzeit liefern muss – inklusive Emojis. Die Ursache? Liegt vielleicht im Kinderstuhl, direkt neben dem Tablet. Wir formen eine Generation, die perfekt weiss, wie man swipet – aber nicht, wie man durch- und aushält. Die alles googeln kann – aber kaum noch hinterfragt. Die ihr Wissen in der Cloud bewirtschaftet, viel weiss und doch keine Ahnung hat. Die dauererreichbar ist – aber kaum mehr bei sich selbst ankommt.
Casual Friday ist jetzt immer – auch im Vorstellungsgespräch
Der Schlabberlook hat das Home-Office nie verlassen. Was als pandemische Notlösung begann, ist heute modischer Dauerzustand. Wer sich einmal an Shorts und Finken (Pantoffeln) gewöhnt hat, will sie auch mit ins Büro nehmen – wenn es denn überhaupt noch eines gibt. Der Jogginganzug wurde zum neuen Business-Outfit, das Sakko zur Zoom- oder Teams-Kulisse. Die Kamera zeigt den Oberkörper, die Jogginghose bleibt unter dem Radar. Und wer heute zum Vorstellungsgespräch erscheint, bringt vielleicht nicht nur Qualifikationen mit, sondern auch eine gehörige Portion nonchalanter Lässigkeit – im wahrsten Sinne des Wortes.
Warum sich Mühe geben, wenn der Bildschirm eh nur den Oberkörper zeigt? Warum sich rasieren, die Haare kämmen oder gar Schuhe anziehen, wenn sowieso niemand den ganzen Menschen sieht? Präsenzkultur war gestern, der Mensch ist heute ein simpler vielleicht bestenfalls definierter Torso mit WLAN. Die Dresscodes sind gefallen, nicht aus modischer Rebellion, sondern aus schlichter Bequemlichkeit. Die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit ist verwischt – und mit ihr auch die zwischen Berufsoutfit und ‘Bedtimelook’. Die Pyjamahose unter dem Schreibtisch ist längst kein Geheimnis mehr, sondern stille Übereinkunft. Sozusagen der neue Standard der Beliebigkeit!
Und selbst bei Bewerbungsgesprächen gilt zunehmend: Frugale Bescheidenheit des optischen Seins, Echtheit oder heute neudeutsch ausgedrückt Authentizität vor Auftritt. Wer sich zu sehr in Schale wirft, wirkt verdächtig – zu bemüht, zu angepasst. Ein gepflegter Look? Könnte Unsicherheit kaschieren. Ein zerknittertes, vielleicht sogar beflecktes T-Shirt? Könnte für ‘nahbar’ stehen. Der neue Dresscode ist: so, wie du dich wohlfühlst. Und wenn das bedeutet, dass das Outfit eher nach Sonntagnachmittag, Biergarten oder Schrebergarten als nach Karriereleiter aussieht – bitte sehr. Denn in einer Welt, in der Professionalität immer öfter mit Flexibilität verwechselt wird, genügt es offenbar, nicht auf der Couch zu liegen.
Doch was verloren geht, ist mehr als nur Stoff: Es ist das Bewusstsein für den Moment, für das Gegenüber, für den Respekt gegenüber der Situation. Kleidung war nie nur Hülle – sie war Haltung und Ausdruck. Und wer sich diese Haltung abtrainiert, riskiert, dass auch andere Standards folgen: Kommunikationsstil, Reaktionszeit, Verbindlichkeit. Vielleicht ist der Casual Friday deshalb nicht nur ein modisches Symptom, sondern ein Spiegelbild einer Arbeitswelt, die zunehmend den Anspruch an sich selbst verliert – zugunsten von Komfort, aber auf Kosten von Präsenz.
Machtgehabe in Kapuzenpullis
Die Rollen haben sich massiv verschoben – und wie. Früher waren Gäste noch ‘Herrschaften’, mit Anstand, Manieren, Haltung und einem gewissen Gespür für soziale Codes. Heute wirken sie, als wären sie direkt aus dem Schlafsack ins Fünfgangmenü gefallen. Kapuzenpulli statt Kragenhemd, pompöse Sneaker statt Lederschuh, und mittendrin der Aufdruck ‘Too cool for rules’, der nicht nur ein modisches Statement, sondern eine Haltung geworden ist. Während sich das Servicepersonal nach wie vor darum bemüht, Professionalität und Stil zu verkörpern, wird es vom neuen Gast der digitalen Boheme mit lässiger Ignoranz abgespeist. Ein freundliches Nicken? Zu viel verlangt. Ein ‘Danke’? Optional. Vielleicht. Der Konsument von heute will bedient werden – aber bitte schön ohne sich selbst zu hinterfragen.
Wer arbeitet, soll bitte auch seriös aussehen. Uniform, Dresscode, Arbeitslächeln – all das wird weiterhin erwartet. Wer konsumiert hingegen, darf alles: sich hinfläzen, frech fordern, ignorant schweigen und imperativ dirigieren. Die eigentliche Macht liegt nicht beim Gastgebenden, sondern ausschliesslich beim Gast. Und je nach Umsatzpotenzial steigt auch die Toleranz für Respektlosigkeit. Der Kapuzenpulli wird zum Symbol einer neuen Arroganz: unnahbar, gleichgültig, scheinbar frei von Konventionen – aber in Wahrheit eine Uniform der fordernden Anspruchshaltung. Hinter dem betont lässigen Look versteckt sich nicht selten ein übersteigertes Selbstbild, das sich für wichtig hält, aber in Wahrheit bloss keine Rücksicht nehmen will.
Das Servicepersonal steht währenddessen stramm – nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Denn wer bedient, muss heute auch ganz selbstverständlich Demütigungen hinnehmen: Blicke, die durch einen hindurchgehen. Bestellungen, die wie Befehle klingen. Und Feedback, das eher nach arroganter Abrechnung als nach Austausch klingt. Der Respekt verläuft einseitig. Höflichkeit wird zur Bringschuld derjenigen, die arbeiten – nicht derjenigen, die zahlen. Der neue Code lautet: Geld ersetzt Anstand. Und wer sich das Essen leisten kann, darf sich benehmen wie im eigenen Wohnzimmer – egal, ob man dort auch die Füsse auf dem Tisch hat und die Krümel daneben achtlos auf den Boden wischt.
So wird der Hoodie zum neuen Symbol der sozialen Schieflage: Er steht nicht mehr für gesellschaftliche Rebellion und systemische Abgrenzung, sondern für eine Nonchalance, die mit wachsender Selbstverständlichkeit über alle Regeln hinwegschwebt – während die, die arbeiten, sich nach wie vor an jede einzelne halten müssen.
Der grosse Irrtum: Toleranz heisst nicht Gleichgültigkeit
Wir haben die Schwelle längst überschritten, an der Rücksichtnahme als Tugend galt. Heute wird sie oft als Zeichen von Schwäche gewertet – von Unsicherheit, von Unentschlossenheit oder gar von ‘Bünzlitum’ (Spiessertum). Wer sich im öffentlichen Raum zurücknimmt, gilt als altmodisch. Wer andere nicht stört, scheint sich selbst nicht wichtig genug zu nehmen. Der neue Imperativ lautet: Präsentiere dich! Und zwar laut, schrill und kompromisslos. Der öffentliche Raum ist zur Bühne einer egozentrischen Selbstverwirklichung geworden – und Rücksichtnahme wird darin höchstens noch als Statistendasein geduldet.
Toleranz, dieses grosse Wort der offenen Gesellschaft, wird zunehmend missverstanden – nämlich als Einladung zur Gleichgültigkeit. ‘Leben und leben lassen’ hat sich verdreht in ein ‘Mach, was du willst – egal, was es mit anderen macht’. Wer sich über Rücksichtslosigkeit ärgert, tut das heute oft nur noch leise und verschnupft.
Nicht aus Anstand, sondern aus Angst, als Meckerer, Stänkerer, Zukurzgekommener, Störenfried oder Moralapostel abgestempelt zu werden. Wer sich beschwert, riskiert ein epischer Shitstorm statt Zustimmung. Also schluckt man runter, senkt den Blick und weicht allen Ärgernissen aus.
Derweil schreiten die Unerschrockenen und Unentwegten weiter – mit lauter Musik im Rucksack, blasierter Influencer-Attitüde im Gesicht und einer Selbstsicherheit, die jede Reaktion als persönlichen Angriff wertet. Kritik? Nur Neid. Aufforderung zur Rücksicht? Ein Angriff auf die persönliche Freiheit. Die Grenze zwischen individueller Entfaltung und rücksichtsloser Ignoranz wird täglich weiter verschoben – immer zugunsten der Lauteren, der Präsenteren, der Dominanteren und der Frecheren.
Die Stillen verlieren immer mehr Terrain. Die Sensiblen schweigen. Die Gesellschaft duldet vieles, weil sie verlernt hat, zu unterscheiden zwischen Freiheit, Beliebigkeit, Ignoranz und dem Einfordern von Mindestregeln.
Doch Toleranz bedeutet nicht, alles hinzunehmen. Es bedeutet nicht, dass jeder Anspruch gleichwertig ist. Und es bedeutet vor allem nicht, dass Rücksichtslosigkeit unter dem Deckmantel der Individualität salonfähig wird. Wir brauchen keine neue Moralkeule, aber ein neues Bewusstsein: dafür, dass Respekt keine Meinung ist – sondern ein Fundament des Zusammenlebens. Denn wenn Gleichgültigkeit zur Norm wird, verliert die Toleranz ihren Sinn. Und der öffentliche Raum – einst Ort der Begegnung – wird zur Arena, in der nicht das bessere Argument zählt, sondern der lauteste Auftritt.
Luxusmarke = Stil? Ein Irrtum in Strass
Dass Eleganz heute oft nur noch simuliert wird, zeigt sich besonders deutlich im Schaufenster der Hochpreisigkeit. Die Modebranche, einst Hort des guten Geschmacks und der Ästhetik, inszeniert sich heute als Zirkus der Eitelkeiten. Designermarken verkaufen durchlöcherte Jeans zu vierstelligen Beträgen, fellbesetzte Badeschlappen für die Laufstege dieser Welt, und Sweatshirts mit Logos so gross wie Werbetafeln.
Der Look? Irgendwo zwischen Schlafanzug und Partykeller, mit einer Prise ‘Gerade aufgestanden – aber stinkreich’. Was früher Understatement war, ist heute Overstatement in Neonfarben. Das Preisschild ist der Statusbeweis.
Die Botschaft dieser schrillen Mode ist eindeutig: Du bist, was du dir leisten kannst – nicht, wie du auftrittst. Haltung, Stilbewusstsein, Geschmack? Nett, aber zweitrangig. Entscheidend ist nicht mehr, ob Kleidung zur Persönlichkeit passt oder zum Anlass, sondern ob das Logo oder die Marke laut genug brüllt.
Das Prinzip des stillen Raffinements wurde ersetzt durch visuelle Opulenz. Und so wird der Catwalk des Lebens zur Bühne für eine Mode, die sich nicht mehr als Ausdruck von Charakter versteht, sondern als plumpe Investition in Sichtbarkeit.
Der Widerspruch dabei? Wer heute bewusst stilvoll, dezent auftritt – schlicht, hochwertig, ohne Markenlärm – wirkt beinahe subversiv. Denn in einer Gesellschaft, in der das obszöne Auffallen das höchste Ziel ist, wird Zurückhaltung zum Aufstand. Und vielleicht ist echter Stil genau das: sich dem Lärm der Logos zu entziehen und trotzdem Präsenz zu zeigen. Nicht über den Preis, sondern über Persönlichkeit.
Hoffnungsschimmer: die Rückkehr der Eleganz
Doch keine Panik. Der modische Verfall ist kein Endzustand – nur eine Phase im ewigen Zyklus des guten (und schlechten) Geschmacks. Trends kommen, Trends gehen – und wie bei jeder Übertreibung ruft sie früher oder später eine Gegenbewegung hervor. Während der eine Teil der Gesellschaft noch in fleckigen Jogginghosen mit Crocs an den Füssen rebelliert, entdeckt ein anderer Teil gerade Bügelfalten, Einstecktücher und Glitzerroben neu.
Junge Menschen, die nie einen Knigge gelesen haben, greifen plötzlich zur Stoffhose mit Bügelfalte. Teenager, die auf Tiktok oder Instagramm tanzen, schlüpfen abends in Samtblazer oder Pailetten-Ensembles. Das Aufbrezeln feiert ein glamouröses Comeback – als Statement, als Spiel, als bewusster Gegenentwurf zur gepflegten Gleichgültigkeit.
Der Reiz des Schönen, des Gekonnten, der Eleganz – er ist nicht tot, er hat sich nur versteckt. In kleinen Bars mit Dresscode. Auf privaten Dinnerpartys mit Stoffservietten. Auf Social-Media-Kanälen, auf denen wieder Frisuren frisiert und Schuhe geputzt werden.
In Secondhand-Boutiquen, wo man plötzlich wieder nach Qualität tastet, statt nach Marken zu schreien. Wer sich heute elegant kleidet, tut das nicht mehr aus Konvention – sondern aus Überzeugung. Es ist keine Pflicht mehr, sondern eine Freude. Kein Zwang, sondern ein Privileg. Und darin liegt ein Hoffnungsschimmer.
Vielleicht – ganz vielleicht – kommt sogar wieder der Moment, wo man im ÖV Musik hört, ohne sie mit dem halben Waggon zu teilen. Wo Gespräche nicht mit 89 Dezibel geführt werden. Wo das Öffentliche wieder ein Raum des Miteinanders wird – statt nur Bühne der Selbstverwirklichung.
Vielleicht wird die Eleganz nicht nur äusserlich, sondern auch wieder innerlich entdeckt. In der Sprache. In der Art, wie man anderen begegnet. In der Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen – und dadurch erst wirklich präsent zu sein.
Nachgang
Was bleibt, ist ein leises Innehalten – vielleicht sogar ein melancholisches. Denn bei allem Sarkasmus, bei aller Zuspitzung und Polemik in der Beobachtung: Es geht hier nicht nur um Dresscodes, Handygewohnheiten, Lautstärke oder rüpelhaftes Benehmen. Es geht um das fragile Fundament unseres Zusammenlebens – um Respekt, um Achtsamkeit, um ein Gespür füreinander. All das scheint im grellen Scheinwerferlicht der Selbstinszenierung zunehmend zu verblassen.
Doch genau darin liegt auch die Chance. Denn was verloren geht, lässt sich zurückerobern. Nicht mit dem Zeigefinger, nicht mit moralinsauren Vorhaltungen, nicht mit Verbotslisten, sondern mit einem einfachen Gedanken: Dass Rücksicht kein Rückschritt ist. Dass Stil nicht zwingend teuer sein muss. Und dass wahre Präsenz oft leise beginnt – mit einem Blick, einem Dankeschön, einem Moment echter Aufmerksamkeit.
Denn wer wirklich ‚too cool for rules‘ ist, braucht keine Lautstärke, keine grellen Signaturen und Logos und keine Likes – sondern nur das Wissen, dass echte Klasse niemals aus der Mode kommt.