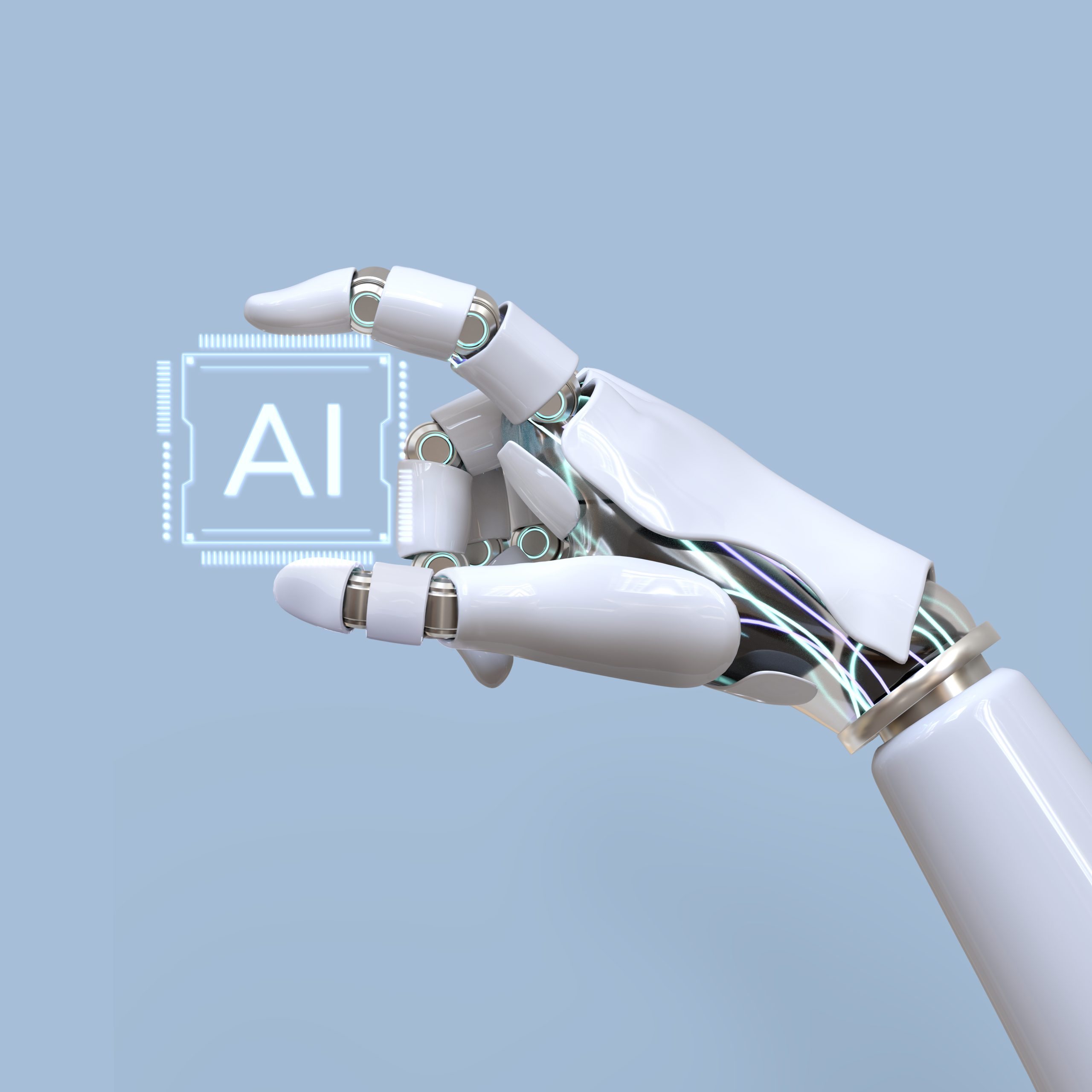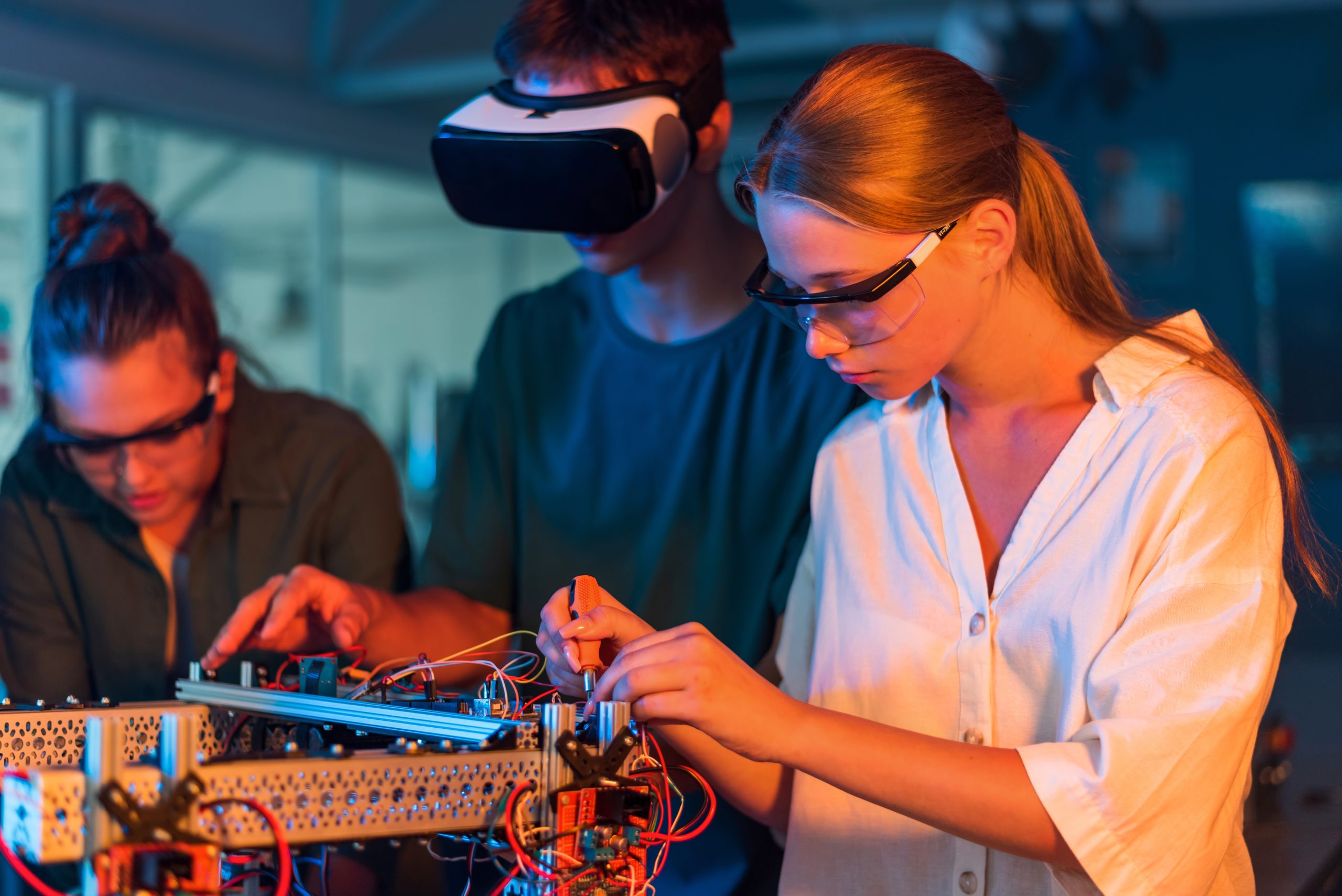In der Schweiz darf man alles, ausser scheitern…
Die Frage ist nicht mehr, ob der globale Wettlauf um Talente stattfindet. Die Frage ist: Wer gewinnt und wer verliert. Während die grossen Volkswirtschaften instabiler, unzugänglicher und ideologisch radikalisierter werden, bietet sich kleinen, verlässlichen Ländern eine historische Chance.
Die Schweiz steht wie keine zweite Nation für Sicherheit, Stabilität, Effizienz und Bildungsqualität. Doch sie nutzt diese Vorzüge nicht immer als Hebel, sondern als Ausrede für den schleichenden Stillstand. Dabei könnten wir längst eine führende Rolle übernehmen, als wirtschaftlicher Hafen für Berufstalente aus aller Welt, als gut rotierende Drehscheibe für zukunftsweisende Unternehmen und als intellektuelles Kraftwerk Europas. Doch wer nur verwaltet, wird nicht gestalten.
Hochschulen entglobalisiert: Ein System im Rückwärtsgang.
Die Schweizer Universitäten geniessen Weltruf und erscheinen regelmässig in den Top-Rankings, zumindest auf dem Papier. In der Praxis aber sind sie oft abgeschottet, bürokratisch und auf dem internationalen Parkett schwer zugänglich. Ein junger Mensch aus Brasilien, Ghana oder Indien, der hier studieren will, scheitert nicht an seinen Fähigkeiten, sondern an Sprachzertifikaten. Während andere Länder gezielt englischsprachige Studiengänge aufbauen, hängen wir an Deutsch und Französischpflichten, als ginge es um die nationale Selbstbehauptung.
Und das hat Folgen: Die besten Köpfe gehen lieber nach Amsterdam, Kopenhagen oder Toronto. Länder, die schon sehr früh erkannt haben: Bildung ist kein Privileg für Einheimische, sondern ein Hebel für die Zukunftssicherung und zudem ein sehr wertvoller Rohstoff. Die Schweiz dagegen bleibt gefangen im föderalen Flickenteppich, ohne strategischen Blick für den globalen Talentpool.
Was wäre zu tun? Radikale Öffnung. Englischsprachige Bachelorstudiengänge. Brückensemester. Visa für Studieninteressierte ohne permanente Hürden. Und vor allem: ein Umdenken im Selbstverständnis unserer Hochschulen. Bildung darf nicht abschrecken, sie muss anziehen wie ein Magnet.
Talente ausbilden, um sie dann wieder auszuweisen?
Jahr für Jahr investiert die Schweiz mit viel Steuersubstrat Millionen in die Ausbildung internationaler Studierender. Und was passiert nach dem Diplom? Viele von ihnen bekommen keine Aufenthaltsbewilligung, dürfen nicht arbeiten und müssen ausreisen, obwohl sie dringend gesuchte Fachkräfte sind. Diese Praxis ist wirtschaftlicher Unsinn und ein grosser Nachteil. Kein Land der Welt kann es sich leisten, Hochqualifizierte auf dem Silbertablett davonziehen zu lassen.
Man stelle sich vor: Eine brillante Informatikerin aus Vietnam absolviert ihr Masterstudium in Lausanne, hat ein Stellenangebot in einem Schweizer Medtech-Startup und erhält trotzdem keine Aufenthaltsbewilligung. Kein Einzelfall, sondern Alltag. Das ist nicht nur unlogisch, sondern ein systemisches Versagen erster Güte. Wir investieren viel in kluge Köpfe und wenn diese gut gefüllt sind, sagen wir diesen ohne Not adieu.
Was wäre zu tun? Eine automatische Bleibeperspektive für Absolventinnen und Absolventen mit Jobangebot. Ein Talent-Visum für Hochqualifizierte. Ein Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Politik und Bildung: Wer hier lernt, darf auch hier aufbauen. Alles andere ist Selbstsabotage.
Unternehmertum made in Switzerland? Lieber nicht, danke.
Wer hier ein Unternehmen gründen will, braucht Geduld, Kapital und eine gewisse Schmerzresistenz. Vor allem, wenn er oder sie aus einem Drittstaat stammt. Die regulatorischen Hürden sind hoch, die Gründungskosten abschreckend, die Prozesse altmodisch. Und das in einem Land, das sich selbst gerne als Innovationsstandort bezeichnet.
Die Wahrheit ist: Die Schweiz bevorzugt etablierte Strukturen. Die grossen Konzerne. Die sicheren Pfade. Startups dagegen stören. Sie fordern heraus, sie riskieren, sie scheitern. Und genau das braucht es. Denn Innovation entsteht nicht im Verwaltungsapparat, sondern in Prototypen, im Experiment, im Unvollkommenen.
Was wäre zu tun? Ein unkompliziertes Startup-Visum. Digitale Gründungsprozesse. Steuerliche Entlastung in der Anfangsphase. Zugang zu Coworking-Infrastruktur. Und vor allem: ein Klima, das Ideen nicht abwehrt, sondern auffängt und ermutigt.
Forschung top, Finanzierung flop
Die Schweiz hat eine hervorragende Forschungslandschaft, doch sie fehlt sich selbst. Die Investitionen sind stabil, aber mutlos. Es gibt keine grossen strategischen Programme für KI, CleanTech oder Quantencomputing. Keine nationale Vision für die Forschung der Zukunft. Alles funktioniert, aber nichts beflügelt wirklich.
Andere Länder oder Regionen machen es vor:
- Das israelische ‘Yozma-Programm’,
- die amerikanischen ‘DARPA-Initiativen’,
- Europas ‘Horizon-Strategie’.
Sie alle setzen gezielt starke Impulse, verbinden Wissenschaft mit Wagniskapital und schaffen gut gedeihende Ökosysteme. In der Schweiz dagegen bleibt Forschung oft isoliert, in Labors, auf Konferenzen, in Projektberichten.
Was wäre zu tun? Staatlich kofinanzierte Innovationsfonds. Matching-Fonds für Private. Strategisch getriebene Forschungsprogramme mit internationaler Ausstrahlung. Und eine übergeordnete nationale Forschungsagenda, nicht nur für Hochschulen, sondern für die ganze Gesellschaft.
Warum Scheitern in der Schweiz peinlich ist, und das ein Problem ist.
In der Schweiz gilt: Wer scheitert, hat versagt. Punkt. Es ist ein Stigma sondergleichen. Es gibt kaum kulturelle Akzeptanz für den Versuch, für das Risiko, für das Wiederaufstehen. Dabei ist genau das der Nährboden für Innovation. Kein Uber, kein Google, kein BioNTech ist beim ersten Versuch durchgestartet. Wer Neues wagt, muss auch fallen dürfen.
Doch hierzulande wird das Scheitern stark stigmatisiert. Insolvenzen werden gesellschaftlich tabuisiert, persönliche Risiken vermieden, Absicherungsmechanismen überreguliert. Das erzeugt Angst und lähmt eine ganze Generation potenzieller Gründerinnen und Gründer.
Was wäre zu tun? Öffentlich geförderte zweite Chancen. Insolvenzrechtliche Reformen. Bildungsprogramme zu unternehmerischem Denken. Und ein gesellschaftliches Narrativ, das den Mut feiert, nicht nur den Erfolg.
Von der Weltspitze zum Bittsteller: Schweizer Startups im internationalen Vergleich
Während Startups in den USA mit Millionen geflutet werden, kämpfen junge Gründerinnen und Gründer in der Schweiz oft um jede Finanzierung. Das verfügbare Wagniskapital pro Kopf liegt bei einem Sechstel dessen, was zum Beispiel in den USA investiert wird. Auch Israel ist uns in diesem Bereich weit voraus, obwohl die Bevölkerung deutlich kleiner ist und die geopolitischen Verwerfungen dieses Land ganz anderen Herausforderungen aussetzt.
Venture Capital ist aber nicht nur Geld. Es ist Vertrauen, Mentoring, Zugang zu Netzwerken. All das fehlt in der Schweiz. Wer hier gründen will, muss zuerst ein Einhorn aus dem Hut zaubern, bevor Investoren überhaupt zuhören und Vertrauen fassen.
Was wäre zu tun? Öffentliche und offensive Risikokapitalfonds, steuerliche Anreize für Business Angels, staatlich kofinanzierte Inkubatoren. Und: Öffnung öffentlicher Beschaffungsmärkte für junge Firmen, die was wagen und nicht nur für Altbekannte.
Recruiting muss endlich global gedacht werden
Fachkräftemangel? Ist kein Schreckgespenst aus dem Märchenbuch, sondern da und kann nicht wegdiskutiert werden. Klar. Aber bitte nur Bewerbende mit EU-Pässen. Diese Haltung blockiert den Zugang zu einem superriesigen Reservoir an Talenten. Gerade in High-Tech-Branchen, Forschung oder Pflege könnten internationale Fachkräfte eine enorme Entlastung bringen, wenn man sie denn liesse. Heute scheitern viele Einstellungen am Bewilligungsverfahren. Und selbst wenn der Mensch gefunden ist, heisst das noch lange nicht, dass er bleiben darf.
Was wäre zu tun? Die Schweiz braucht ein globales Talent-Visum, das sich an Qualifikation, nicht an Herkunft orientiert. HR-Abteilungen sollten nicht in an den Behörden-Paragrafen ersticken, sondern gestalten dürfen. Wir brauchen eindeutig viel weniger Hürden und mehr pragmatische Lösungen, die dazu führen, dass die Schweiz vermehrt von den Top-Talenten profitieren kann.
Schweigen ist kein Schutzschild. Es schützt nicht.
Die Schweiz muss sich entscheiden: Will sie ihre Zukunft verwalten oder gestalten? Will sie sich weiter als Hochsicherheitsinsel inszenieren mit geregeltem Zugang, kalkulierter Vielfalt und misstrauischer Integrationslogik? Oder wagt sie endlich den Schritt ins 21. Jahrhundert mit einer echten Vision, mit Offenheit für Talente, mit Mut zu Unvollkommenem?
Wer Talente gewinnen will, muss zuerst das eigene Denken entgrenzen. Die Schweiz hat nicht zu wenig Regeln, sie hat zu wenig Ambition. Nicht zu wenig Potenzial, sondern zu wenig Vertrauen in ihr eigenes Entwicklungspotenzial. Und während wir über Lehrpläne, Quoten und Bewilligungen debattieren, bauen andere Länder mit stupender Geschwindigkeit längst die Arbeitswelt von morgen.
Wer keine Fehler erlaubt, erzeugt Stillstand. Wer keine Neuanfänge ermöglicht, verhindert Innovation. Wer kein Scheitern zulässt, sabotiert Erfolg.
Diese Erkenntnis ist unbequem und mühsam. Aber sie ist überlebenswichtig. Wenn wir nicht bald fortschrittlicher werden, wenn es um diese Fragen geht, wird das Talent von morgen einfach woanders Wurzeln schlagen und wir werden zusehen, wie aus ‘Swiss Made’ ein nostalgisches Qualitätslabel wird mit Heidi, das uns zulächelt. Nett, aber einfach irrelevant.