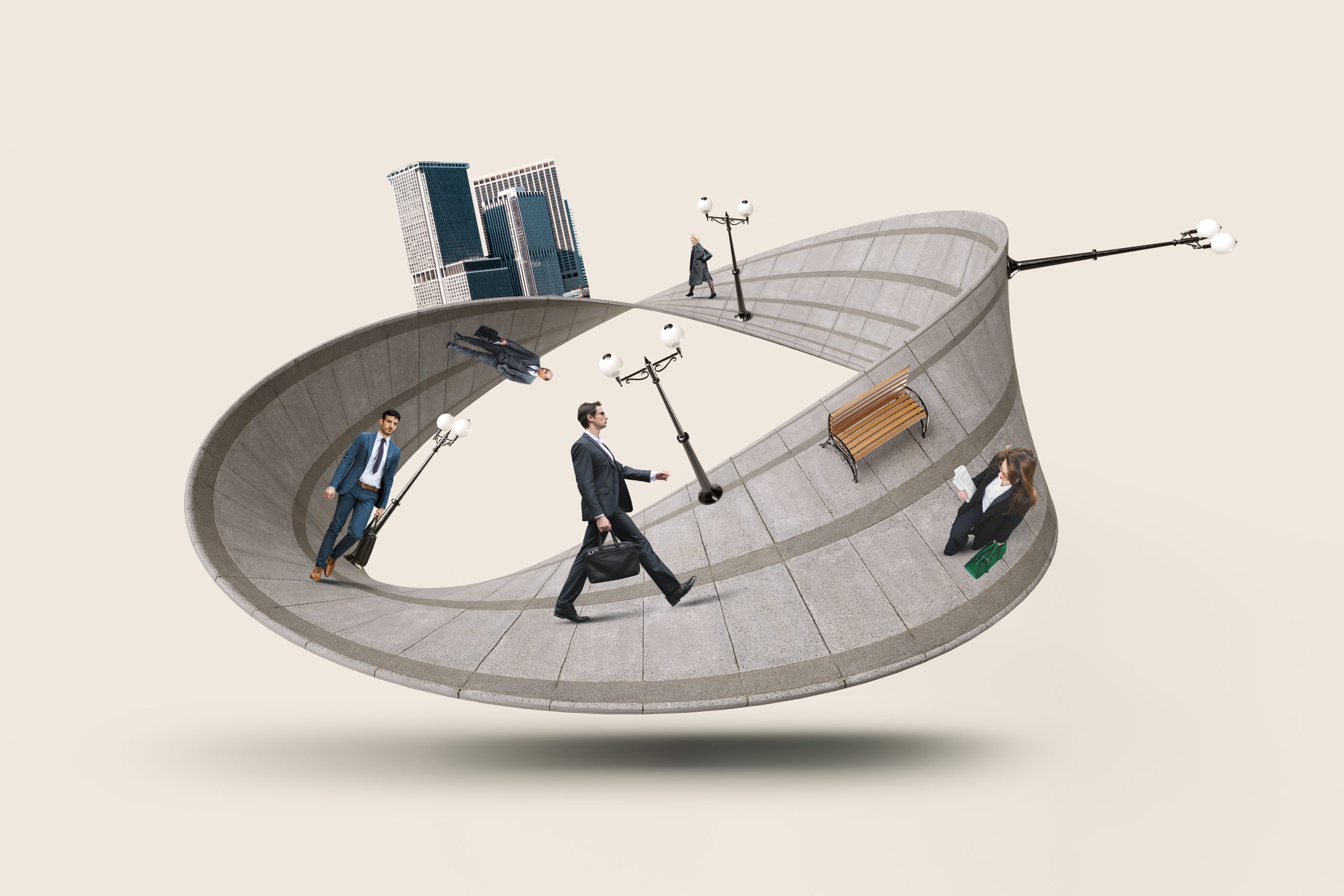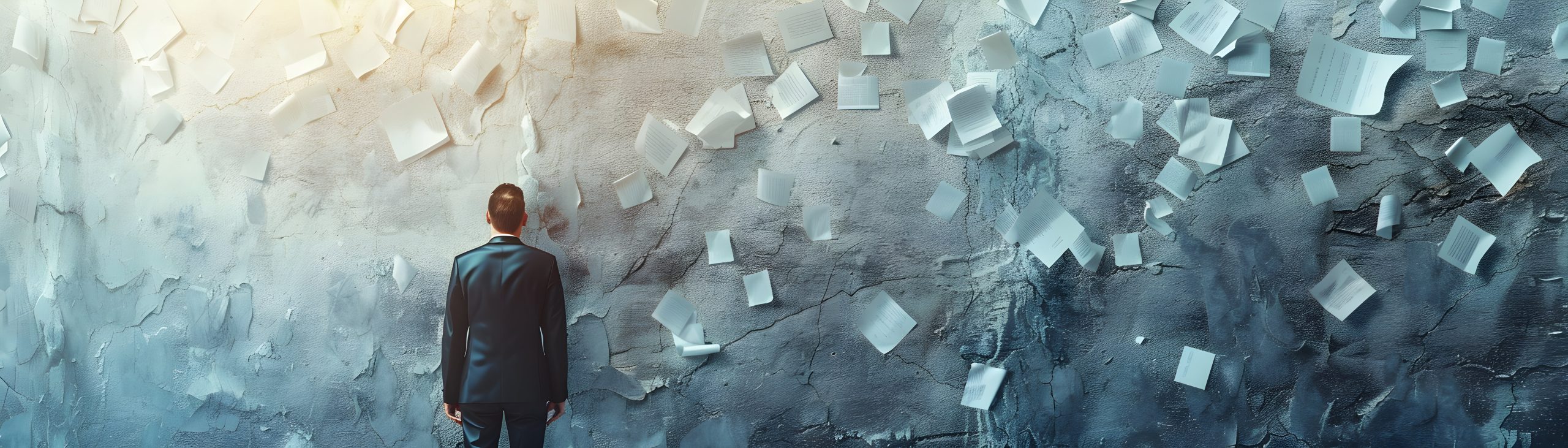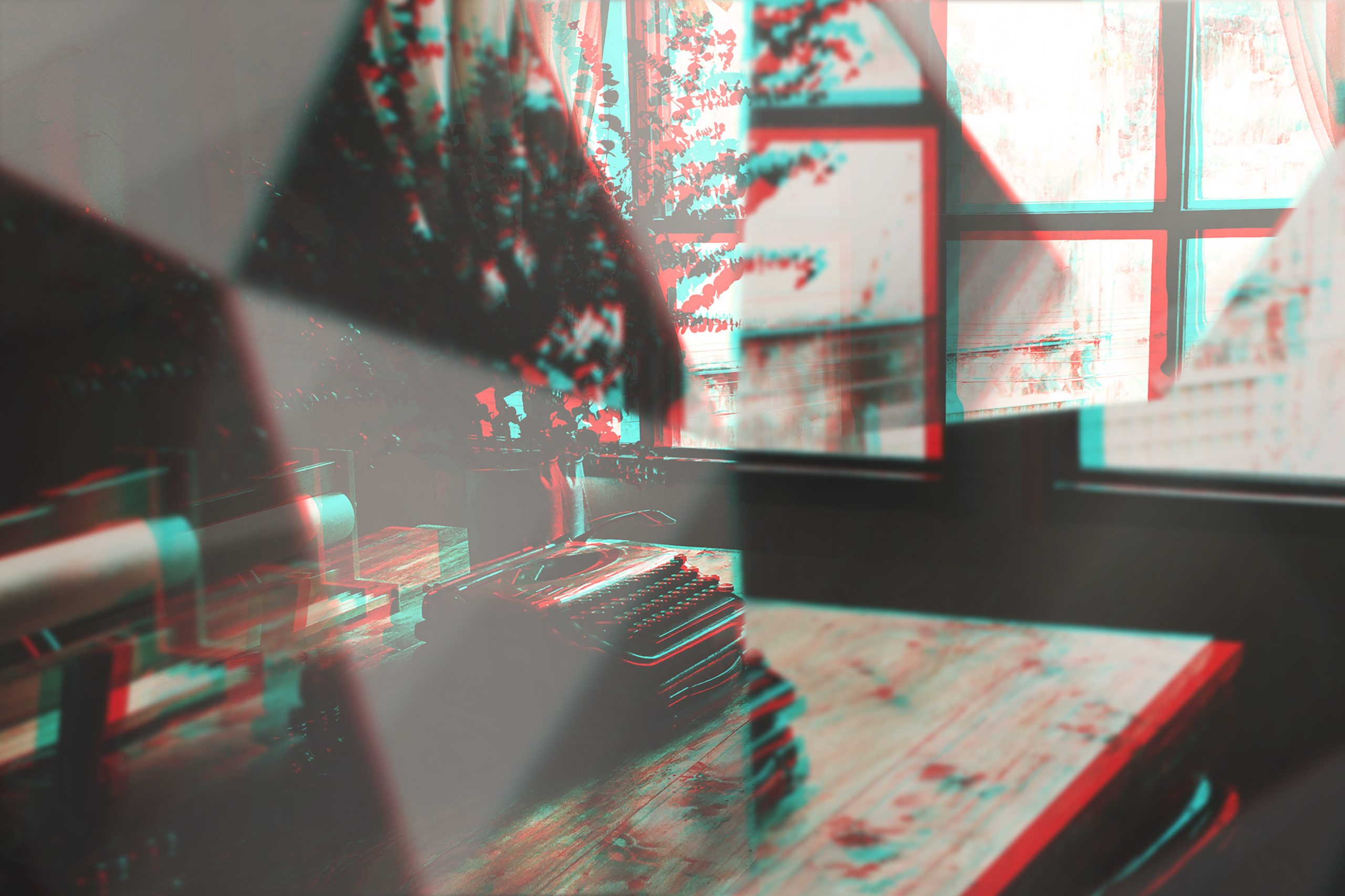Die Automatisierungswelle: Viele Jobs sind gefährdet…
Im Jahr 2013 erschien eine besorgniserregende Studie, die mehr war als eine akademische Übung: ‘The Future of Employment’ von Frey und Osborne wurde schnell zur Matrix für alle, die sich mit den Umbrüchen der Arbeitswelt befassten.
Die beiden Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass rund 47% aller US-Jobs durch Computerisierung bedroht seien. Auch in der Schweiz wurde das Papier diskutiert, analysiert, dann wieder vergessen.
Die Arbeitswelt damals war noch überraschend analog. Personalabteilungen druckten Dossiers aus, Lebensläufe wurden in Papierform bewertet, das Telefon war das zentrale Kommunikationsmittel, nicht Teams, Zoom, Slack oder andere Anwendungen. Automatisierung war ein Thema, aber kein Brennglas. Digitalisierung war ein Tool, kein disruptiver Systemumbruch.
Informationen zur Studie:
Die Studie ‚The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?‘ von Frey und Osborne untersucht, wie stark verschiedene Berufe durch den technologischen Fortschritt gefährdet sind. Mithilfe eines innovativen Modells schätzen die Autoren die Wahrscheinlichkeit der Automatisierung für 702 Berufe in den USA.
Das zentrale Ergebnis lautet: Rund 47% aller US-Jobs könnten in den kommenden zwei Jahrzehnten durch Computerisierung ersetzt werden. Besonders betroffen sind Tätigkeiten mit niedrigen Löhnen und geringem Ausbildungsniveau, während Berufe, die ein hohes Mass an sozialer Intelligenz, Kreativität oder komplexer Wahrnehmung und manueller Geschicklichkeit erfordern, als vergleichsweise sicher gelten.
Die Studie zeigt, dass der technologische Fortschritt längst nicht mehr auf Routineaufgaben beschränkt ist. Auch viele bisher als ’nicht automatisierbar‘ geltende Tätigkeiten im kognitiven und manuellen Bereich sind zunehmend gefährdet. Getrieben wird diese Entwicklung durch rasante Fortschritte in Bereichen wie maschinellem Lernen, Robotik und der Verarbeitung grosser Datenmengen.
Die Folge ist eine zunehmende Polarisierung des Arbeitsmarkts, mit Beschäftigungszuwächsen in schlecht bezahlten Servicejobs und hochqualifizierten Wissensberufen, während mittlere Qualifikationen zunehmend unter Druck geraten. Die Fähigkeit, sich neue Kompetenzen anzueignen, wird zum entscheidenden Faktor für die Beschäftigungsfähigkeit.
Die Autoren warnen vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Spannungen, die durch eine wachsende technologische Arbeitslosigkeit entstehen könnten, wenn keine adäquaten politischen und bildungspolitischen Massnahmen ergriffen werden. Die Studie versteht sich daher auch als dringender Appell an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sich aktiv mit den bevorstehenden Umwälzungen des Arbeitsmarkts auseinanderzusetzen.
The Future of Employment (72 Seiten auf Englisch, PDF-Format)
Arbeit bedeutete für viele Stabilität. Für andere war sie anstrengend, monoton, aber vorhersehbar. Die sogenannte Mitte, also kaufmännische Angestellte, Bankfachleute, Versicherungsberater:innen, Personalverantwortliche, war sicher in die Arbeitswelt eingebettet. Wer sich bildete, hatte gute Chancen. Wer fleissig war, wurde meistens befördert. Wer konstant lieferte, hatte Arbeitsplatzsicherheit. Die Mechanik der Arbeitswelt war vertraut und stabil.
Doch dieses Gleichgewicht war viel träger als die dynamische Wirklichkeit. Arbeit war damals stark durch Hierarchien, Arbeitsplatzkontinuität und feste Rollenbilder geprägt. Lebenslängliche Anstellungen waren zwar rückläufig, aber immer noch verankert in den beruflichen Erwartungen und Köpfen der Menschen.
Zudem war die forcierte Automatisierung noch kein Massenphänomen. Die Debatte darüber fand vor allem in Expertenzirkeln statt, nicht in Pausenräumen oder bei politischen Wahlkämpfen. Arbeit war sichtbar, physisch, sozial eingebettet. Der Büroalltag war ein Ort von Begegnung, Austausch und Konflikt.
Homeoffice war eher Ausnahme als Normalfall. Die technologische Disruption schien weit entfernt. Ein Thema klar für die Zukunft, aber sicher nicht für die Gegenwart.
Jetzt: Eine Arbeitswelt im Zustand des permanenten Umbruchs
13 Jahre später ist alles anders. Die Digitalisierung ist nicht mehr ein spannendes Add-on als Projekt, sondern der Boden, auf dem alles steht. Was einst ein fortschrittsgetriebener Diskurs war, ist heute eine strukturelle Realität. ChatGPT oder andere sogenannte LLM (Large Language Modell) schreiben Bewerbungen, Bots führen flotte und technisch hochstehende Rekrutierungsgespräche, Algorithmen kündigen Menschen, bevor Vorgesetzte es tun.
Die Arbeitswelt ist fluide, zuweilen prekär und immer mehr fragmentiert. Der Begriff ‘Karriere’ wirkt aus der Zeit gefallen.
In der Schweiz zeigt sich die tektonische Verschiebung besonders deutlich im tertiären Sektor:
- Bankangestellte werden durch günstige ‘Robo-Advisors’ ersetzt,
- Versicherungen lagern ganze Services in automatisierte Kundensysteme aus,
- HR-Abteilungen arbeiten mit KI-gestützter Screeningsoftware.
Die vielzitierte Wissensgesellschaft ist real, aber längst nicht für alle. Wer nicht digital anschlussfähig ist, wird marginalisiert. Wer sich nicht permanent weiterbildet, verliert an Relevanz.
Zugleich erleben wir eine neue Form der Unsichtbarkeit von Arbeit. Viele Prozesse laufen ‘unter dem Radar’ ab, unbemerkt von Kund:innen und oft auch von Mitarbeitenden. Wer nicht versteht, wie Algorithmen Entscheidungen treffen, wird zum Objekt entwertet statt zum Subjekt aufgewertet.
Auch die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit lösen sich zunehmend auf und sind ebenso fluide. Permanentes Online-Sein wird stillschweigend erwartet. Die Arbeitswelt schwebt in einen Zustand der permanenten Beta-Version. Sie ist nie fertig, immer im Wandel und pausenlos in Bewegung.
Und doch ist die neue Arbeitswelt nicht nur einfach technokratisch. Sie ist auch widersprüchlich: Während einerseits händeringend nach Fachkräften gesucht wird, entwertet man gleichzeitig menschliche Arbeit über Effizienzparadigmen, die nie in Frage gestellt werden. Was zählt, ist nicht die Qualifikation, sondern Kompatibilität mit den vorherrschenden Systemen.
Zwischen Zoom-Meetings, Algorithmen und Quartalszielen verliert sich oft die Sinnfrage. Gleichzeitig entstehen neue Berufsbilder in Bereichen wie Data Ethics, Employee Experience und People Analytics mit ungeklärtem Kompetenzprofil. Die Arbeitswelt von heute ist ein Labor. Doch wer gestaltet das alles?
Die grosse Leerstelle: Gesellschaftliche Blindstellen der Automatisierung
Die Automatisierungsdebatte bleibt oft eine betriebswirtschaftliche. Es geht um Produktivität, Effizienz, ROI. Doch was bedeutet es gesellschaftlich, wenn Millionen Jobs verschwinden oder sich so tiefgreifend verändern, dass sie nicht wiederzuerkennen sind? Wenn Arbeit, als Quelle von Identität, Sinn und Teilhabe, schleichend ausgehöhlt und entkernt wird?
Gesellschaftlich betrachtet stehen wir an einem Kipppunkt. Die Entwertung mittlerer Qualifikationen führt zu einer nicht mehr zu verleugnenden Polarisierung: Oben entstehen neue Hochlohnjobs im IT und Innovationsbereich, unten expandiert der Niedriglohnsektor. Dazwischen: Unsicherheit.
Die sogenannte Mitte verliert Sicherheit, Orientierung und oftmals ihren angestammten Platz. Die schleichende Erosion der Sinnhaftigkeit gewöhnlicher Arbeit entmutigt. Die Maschinen übernehmen.
Diese Entwicklung ist nicht nur ein Problem für Individuen, sondern auch für Demokratien. Wer sich aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen fühlt, zieht sich auch politisch zurück oder radikalisiert sich. Arbeit war immer auch ein Ort des Findens, der persönlichen Einordnung und Unterordnung wie auch der korrektiven Sozialisation. Wenn sie zum prekären Zwischenstatus wird, verlieren Gesellschaften ihren sozialen Kitt und fallen auseinander.
Zudem fehlt eine gesellschaftlich getragene Ethik der Automatisierung. Welche Aufgaben wollen wir als Gesellschaft an Maschinen übergeben? Welche nicht? Wo verlaufen die moralischen Grenzen?
Diese Fragen werden bislang weitgehend den Unternehmen überlassen oder an seelenlose Tech-Konzerne ausgelagert, die weder demokratisch legitimiert noch neutral sind. Eine öffentliche Debatte darüber, welche Formen der Arbeit schützenswert sind, steht aus.
Psychologie der neuen Arbeitswelt: Erschöpfung, Entfremdung, Erneuerung?
Arbeitspsychologisch erleben wir eine Zeitenwende. Die klassischen Indikatoren für Arbeitszufriedenheit, wie Autonomie, Sinnhaftigkeit, Entwicklungschancen, werden durch neue Dynamiken unterlaufen. Flexibilisierung, die einst als Befreiung gepriesen wurde, wird für viele zur Belastung.
Permanente Erreichbarkeit, hybride Arbeitsmodelle ohne klare Trennung zwischen Arbeit und Leben, sowie algorithmisch gesteuerte Zielvorgaben führen zu einem Zustand chronischer Anspannung. Burnout ist längst kein Randphänomen mehr, es ist die neue Volkskrankheit schlechthin.
Die emotionale Entkopplung von der Arbeit wird zugleich als neue Produktivitätsform verklärt. Wer weniger Bindung an seine Aufgabe empfindet, ist aus Sicht mancher Unternehmen effizienter steuerbar. Doch diese Logik ist kurzsichtig: Menschen brauchen Sinn, Zugehörigkeit und Anerkennung. Wenn sie diese nicht mehr aus ihrer Arbeit beziehen, entstehen Leerräume, die durch Konsum, Isolation oder Krankheit gefüllt werden.
Besonders betroffen sind sogenannte kognitiv fordernde, aber emotional unterforderte Tätigkeiten. Diese erzeugen bei vielen das Gefühl, zwar zu funktionieren, aber nichts Relevantes mehr zu bewirken. Diese Art von ‘innerer Kündigung’ ist schwer messbar, aber hoch ansteckend. Sie gefährdet langfristig nicht nur die psychische Gesundheit der Einzelnen, sondern auch die ansteckende Innovationsfähigkeit von Organisationen.
Gleichzeitig entwickeln sich neue Formen der Resilienz: Peer-Netzwerke, digitale Co-Working-Communities, achtsamkeitsbasierte Führungskulturen. Junge Generationen bringen eine andere Haltung zur Arbeit mit, nicht weniger Engagement, sondern ein anderes Verständnis von Selbstwirksamkeit. Für HR bedeutet das: weg von der Kultur der überwachten Leistung, hin zur Architektur der psychologischen Sicherheit.
Was kommt: Drei Szenarien für die nächsten zehn Jahre
Szenario 1 – Die grosse Rationalisierung: Technologische Entwicklungen schreiten weiter voran. Künstliche Intelligenz wird in der Lage sein, auch komplexe kognitive Prozesse wie Verhandlungen, Forschung und kreative Textproduktion zu übernehmen. Die Kosten menschlicher Arbeit steigen im Vergleich zu automatisierten Alternativen stark an.
Ganze Berufsbilder verschwinden, besonders in Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen. Der Arbeitsmarkt wird zu einem Schauplatz permanenter Selektion. Der sozialer Aufstieg über Arbeit wird zur Ausnahme. Der gesellschaftliche Zusammenhalt verödet.
Szenario 2 – Die resiliente Anpassung: Ein breiter gesellschaftlicher Konsens entsteht, dass Automatisierung nicht nur technisch, sondern auch ethisch gesteuert werden muss. Weiterbildung wird zum Grundrecht, nicht zur individuellen Bringschuld. Unternehmen schaffen Lernzeit als bezahlte Arbeitszeit. Bildungsinstitutionen reagieren mit flexiblen, transdisziplinären Curricula. Der Staat fördert Umschulungsfonds. HR wird zur proaktiven Transformationsinstanz: Es analysiert Jobprofile nicht nur hinsichtlich Effizienz, sondern auch in Bezug auf ihre gesellschaftliche Funktion.
Arbeit bleibt zentral, wird jedoch gerechter verteilt.
Szenario 3- Die soziale Wende: Getrieben von einer neuen Wertebewegung entsteht ein tiefgreifender Wandel im Arbeitsverständnis. Arbeit wird nicht mehr nur als simple Einkommensquelle, sondern als Teil des Lebensentwurfs betrachtet. Modelle wie das bedingungslose Grundeinkommen, Care-Währungen oder lokale Zeitbanken gewinnen an Bedeutung. Die Rolle von Unternehmen wandelt sich: Sie sind nicht mehr nur Profitmaschinen, sondern gemeinwohlorientierte Organismen.
Technologie wird zur Ermöglichungsstruktur für kürzere Arbeitszeiten, nicht für Massenentlassungen. Die Produktivität steigt durch partizipative Führung und sinnstiftende Tätigkeiten.
Es geht nicht um Technik. Es geht um uns.
Die Studie von Frey und Osborne war nicht nur ein Blick in die Zukunft, sondern ein Spiegel für unsere Gegenwart. Ihre Thesen haben sich in grossen Teilen bewahrheitet, aber die gesellschaftliche Debatte darüber blieb aus.
Was wir aus ihr lernen können? Dass die Arbeitswelt kein Naturereignis ist, sondern gestaltbar. Dass Technologie nie neutral ist, sondern immer in aller Brutalität Machtverhältnisse spiegelt. Und dass es die Aufgabe aller ist, Arbeit neu zu denken: menschlicher, gerechter, nachhaltiger.
Die grosse Frage lautet nicht: Welche Jobs wird es in zehn Jahren noch geben? Sondern: Welche Gesellschaft wollen wir sein, wenn diese Jobs verschwinden? Die Zukunft der Arbeit liegt nicht in der humanen Cloud, auf die man einfach zugreifen kann, sondern im Mut, Systeme konsequent zu hinterfragen, Narrative ganz nüchtern zu entzaubern und Alternativen zu denken.
HR kann dabei Wegbereiterin oder Mitläuferin sein. Entscheidend ist, ob wir den Wandel verwalten oder endlich gestalten.