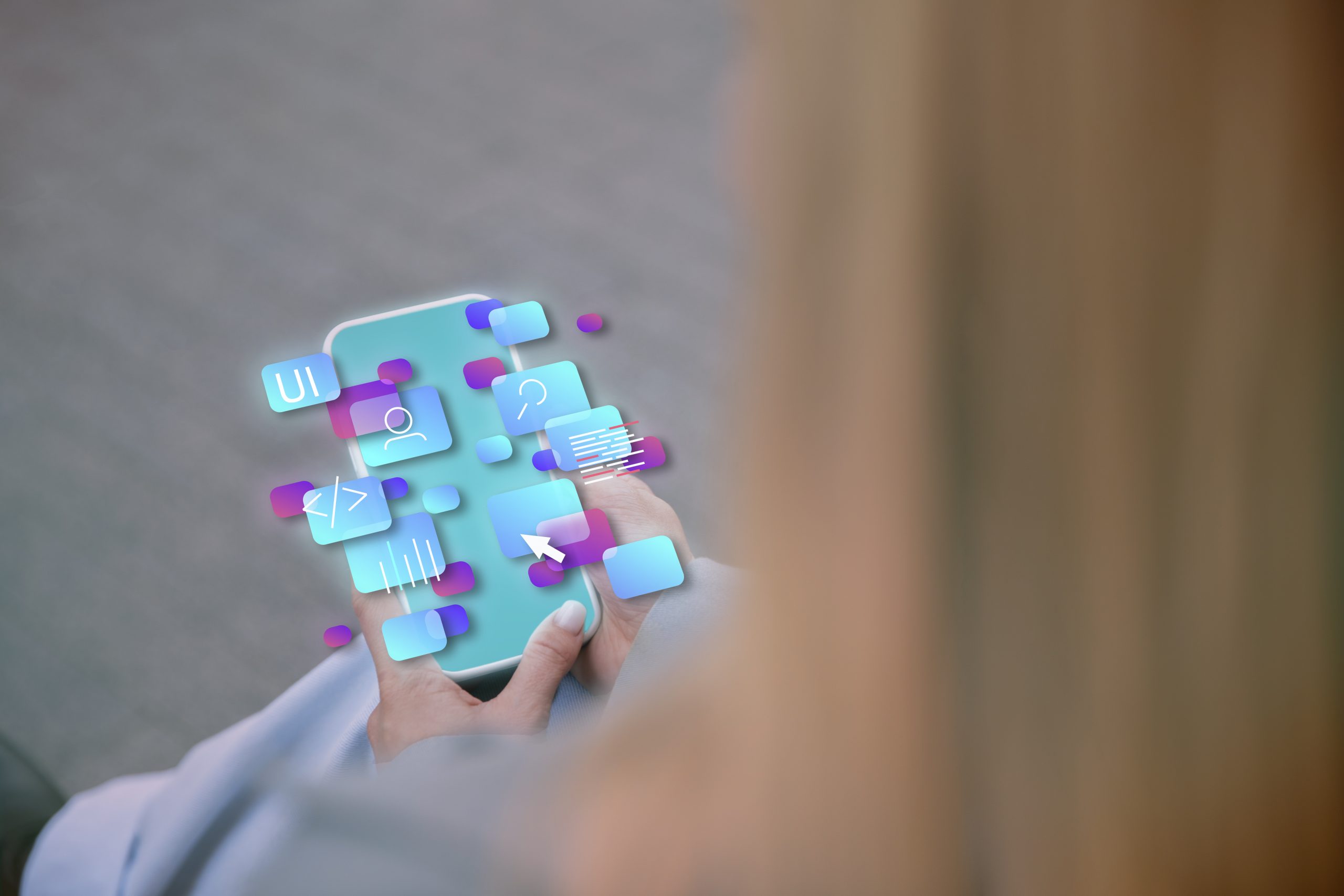Verlieren Rekruter:innen wegen KI ihre Jobs?
Basel, 08:12 Uhr, Dienstagmorgen. Ein erfahrener Recruiter sitzt an seinem Schreibtisch in einem mittelgrossen Industrieunternehmen. Seit zwölf Jahren besetzt er Schlüsselpositionen, hat in unzähligen Gesprächen Kandidat:innen überzeugt, skeptische Hiring Manager besänftigt und so manche Rettungsaktion gestartet, wenn ein Top-Talent drohte, abzuspringen. Er öffnet seinen Laptop, klickt auf das E-Mail-Postfach und liest:
Betreff: ‘Änderung Ihrer Rolle im Recruitingprozess’
Text: ‘Sehr geehrter Herr M., ab dem 1. des kommenden Monats werden Ihre Aufgaben vollständig durch unser neues KI-gestütztes Recruitment-System übernommen. Ihre Expertise wird im Rahmen der Prozessüberwachung weiterhin geschätzt.’
Keine Erklärung, kein persönliches Gespräch, kein Dank für ein Jahrzehnt Arbeit. Nur eine Nachricht, generiert von einer Software, die vermutlich nicht einmal wusste, dass sie damit eine menschliche Karriere beendete. Der Recruiter starrt auf den Bildschirm. Die Ironie entgeht ihm nicht: Er wurde von derselben Technologie ersetzt, die er vor zwei Jahren noch als ‘spannendes Pilotprojekt’ mit eingeführt hatte.
Vom Werkzeug zum Ersatz
Technologie hat Recruiting schon immer verändert. Vom handgeschriebenen Stelleninserat in der Zeitung der 1970er, über den Faxversand von CVs in den 80ern, bis hin zu den ersten Online-Jobportalen um die Jahrtausendwende. Jede Neuerung versprach Entlastung und brachte Effizienz. Aber eines blieb gleich: Die finale Auswahl, das Abwägen, das Bauchgefühl all das blieb menschlich.
Mit der aktuellen KI-Generation stehen wir erstmals vor einer anderen Qualität der Veränderung. Sie ist nicht länger ein Werkzeug, das menschliche Entscheidungen unterstützt. Sie wird zur Instanz, die diese Entscheidungen vorbereitet, beeinflusst und bald vielleicht auch komplett übernimmt.
Wenn ein Algorithmus selbstständig Kandidat:innen sucht, kontaktiert, Gespräche ansetzt, Feedback auswertet und Entscheide vorbereitet, dann ist der Mensch nicht mehr Entscheider, sondern nur noch ein stupider Abnicker. Die Rolle des Recruiters verschiebt sich von der Steuerung zur Überwachung. Und Überwachung ist kein Berufsfeld mit Zukunft.
Der Mythos der allwissenden Maschine
Die Vision der Tech-Unternehmen klingt verführerisch: Ein KI-Agent, tief integriert in einen Browser, der den gesamten Recruitingprozess autonom steuert. Er erkennt Anforderungen, durchsucht Datenbanken, gleicht Profile ab, erstellt personalisierte Anschreiben, koordiniert Termine, verschickt Einladungen und analysiert im Anschluss die Gesprächsprotokolle.
Doch der Schweizer Arbeitsmarkt funktioniert nicht wie ein standardisierter Fertigungsprozess. Ein Maschinenbauingenieur aus St. Gallen, eine Pflegefachkraft aus Lausanne oder ein Bauleiter aus dem Wallis sind nicht austauschbare Datenpunkte. Sie sind eingebettet in regionale Bindungen, branchenspezifische Kulturen und persönliche Lebensumstände.
KI kann das nicht in der Tiefe erfassen. Sie weiss nicht, dass eine Kandidatin trotz perfektem Profil gerade eine pflegebedürftige Mutter hat und deshalb kein Job mit hoher Reisetätigkeit infrage kommt. Sie kann nicht spüren, dass ein Bewerber zwar überdurchschnittliche Skills hat, aber im Erstgespräch eine unterschwellige Skepsis zeigt, die auf tieferliegende Motivationsprobleme hinweist. Der Mythos der perfekten Maschine blendet diese Realität aus. Und genau darin liegt die Gefahr.
Von der ‘Befreiung’ zur betriebswirtschaftlichen Kaltlogik
Die Rhetorik der Tech-Branche ist perfide geschickt: KI wird als Befreiung von lästigen Routineaufgaben verkauft. ‘Mehr Zeit fürs Wesentliche’, heisst es. Doch wer den Schweizer Unternehmensalltag kennt, weiss: Sobald Prozesse effizienter werden, werden Ressourcen erbarmungslos gekürzt. Alle Hemmungen fallen.
Kaum ist die Software installiert, rechnet das Controlling nach: ‘Wenn die Maschine 80 Prozent der Arbeit macht, wozu noch fünf Recruiter?’ Aus ‘Befreiung’ wird Rationalisierung, aus ‘Unterstützung’ wird kalter Personalabbau. Besonders brisant ist dabei, dass dieser Prozess nicht an den Toren grosser Konzerne halt macht. Auch mittelgrosse Schweizer Unternehmen, die traditionell auf persönliche Kontakte und langfristige Beziehungen setzen, geraten in den Sog. Wer nicht automatisiert, verliert an Tempo. Und wer Geschwindigkeit verliert, verliert Marktanteile.
‘Gut genug’ ist die gefährlichste Managementlüge
Der wohl folgenreichste Denkfehler der Automatisierungs-Euphorie lautet: ‘Es reicht, wenn die Ergebnisse gut genug sind.’ Wenn eine Position monatelang offensteht, klingt jeder halbwegs passende Kandidat oder Kandidatin wie ein Erfolg. Doch Recruiting ist keine Notfallversorgung. Die Sache ist strategisch. Ein mittelmässiger Kandidat in einer Schlüsselrolle kann ein Projekt verzögern, Innovationen blockieren, ganze Teams demotivieren oder verdammt viel Geld verbrennen. Die Kosten solcher Fehlbesetzungen tauchen in keiner ROI-Kalkulation der KI-Anbieter auf. Sie hinterlassen ihre fatalen Spuren erst Jahre später in gescheiterten Projekten oder hoher Fluktuation aus.
Erfahrene Recruiter spüren in einem halbstündigen Gespräch Nuancen, die sich nicht in Datensätzen abbilden lassen. Eine KI bewertet ‘Matching Scores’, ein Mensch erkennt Ambitionen, Werte und implizite Signale. Wer diesen Unterschied opfert, spart kurzfristig und zahlt langfristig doppelt, wenn nicht noch mehr.
Die Illusion der Fairness
Befürworter betonen gern die ‘Objektivität’ der KI. Keine Vorurteile, keine Sympathiefallen. Doch Algorithmen sind nicht neutral. Auch sie reproduzieren lediglich die Muster, mit denen sie gefüttert werden. Wenn ein Unternehmen zehn Jahre lang vorwiegend Kandidat:innen aus einem bestimmten demografischen Profil eingestellt hat, wird die KI dieses Profil als Optimum interpretieren. Das Ergebnis ist eine unbewusste, aber hartnäckige Diskriminierung aller, die nicht ins bisherige Muster passen. In der Schweiz, wo Diversität nicht nur ein Schlagwort, sondern ein wirtschaftlicher Überlebensfaktor ist, kann diese unreflektierte Homogenisierung ganze Branchen lähmen. Kreative Lösungen entstehen nicht aus Gleichförmigkeit, sie entstehen aus Reibung, aus Perspektivenvielfalt, aus kulturellem Mix.
Was wir wirklich verlieren könnten
Wenn wir das Recruiting vollständig an Maschinen auslagern, verlieren wir nicht nur Jobs, wir verlieren ebenso Kultur, Beziehungskompetenz und die Fähigkeit, das Unplanbare zu managen. Stellen Sie sich einen Arbeitsmarkt vor, in dem alle Unternehmen dieselben KI-Agenten nutzen, dieselben Profile finden, dieselben Nachrichten versenden. Die Kommunikation verkommt zur Massenware, Talente werden wie Konsumgüter behandelt, und die Arbeitgebermarke verliert jede individuelle Note. Langfristig führt das zu einer sehr eintönigen ‚Recruiting-Monokultur‘: effizient, standardisiert, seelenlos und stinklangweilig.
HR zwischen Anpassung und Selbstabschaffung
Die technologische Entwicklung wird nicht warten, bis das HR bereit ist. KI wird kommen. In Wellen, immer leistungsfähiger, immer tiefer in Prozesse integriert. Die Frage ist: Wird HR zum Gestalter oder zum Opfer dieses Wandels? Wer KI unreflektiert einführt, ohne strategischen Rahmen, wird mittelfristig zum Prozessverwalter degradiert. Wer hingegen bewusst definiert, welche Aufgaben automatisiert werden und wo menschliche Interaktion unverzichtbar bleibt, kann die Technologie als Verstärker nutzen, statt als Ersatz. Das bedeutet: mehr Fokus auf Netzwerkpflege, auf Gesprächsführung, auf kulturelle Checks und weniger auf jene Tätigkeiten, die eine Maschine tatsächlich besser kann.
Die Zukunft gehört denen, die den Mensch-Faktor verteidigen
Es wird nicht reichen, einfach ‘mit der Zeit zu gehen’ und ein paar neue Tools einzuführen. Die Zukunft des Recruitings hängt davon ab, ob wir den Mut haben, die unersetzlichen Stärken menschlicher Arbeit sichtbar zu machen und sie gegen den Kostendruck zu verteidigen. Die ehrliche Stärke im Recruiting besteht nicht darin, Prozesse auf Knopfdruck zu erledigen. Sie besteht darin, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur für den nächsten Quartalsbericht, sondern für die nächsten fünf Jahre Bestand haben. Wer das jedoch vergisst, wird bald feststellen, dass er nicht nur Kandidat:innen, sondern auch seine eigene Berechtigung verloren hat.