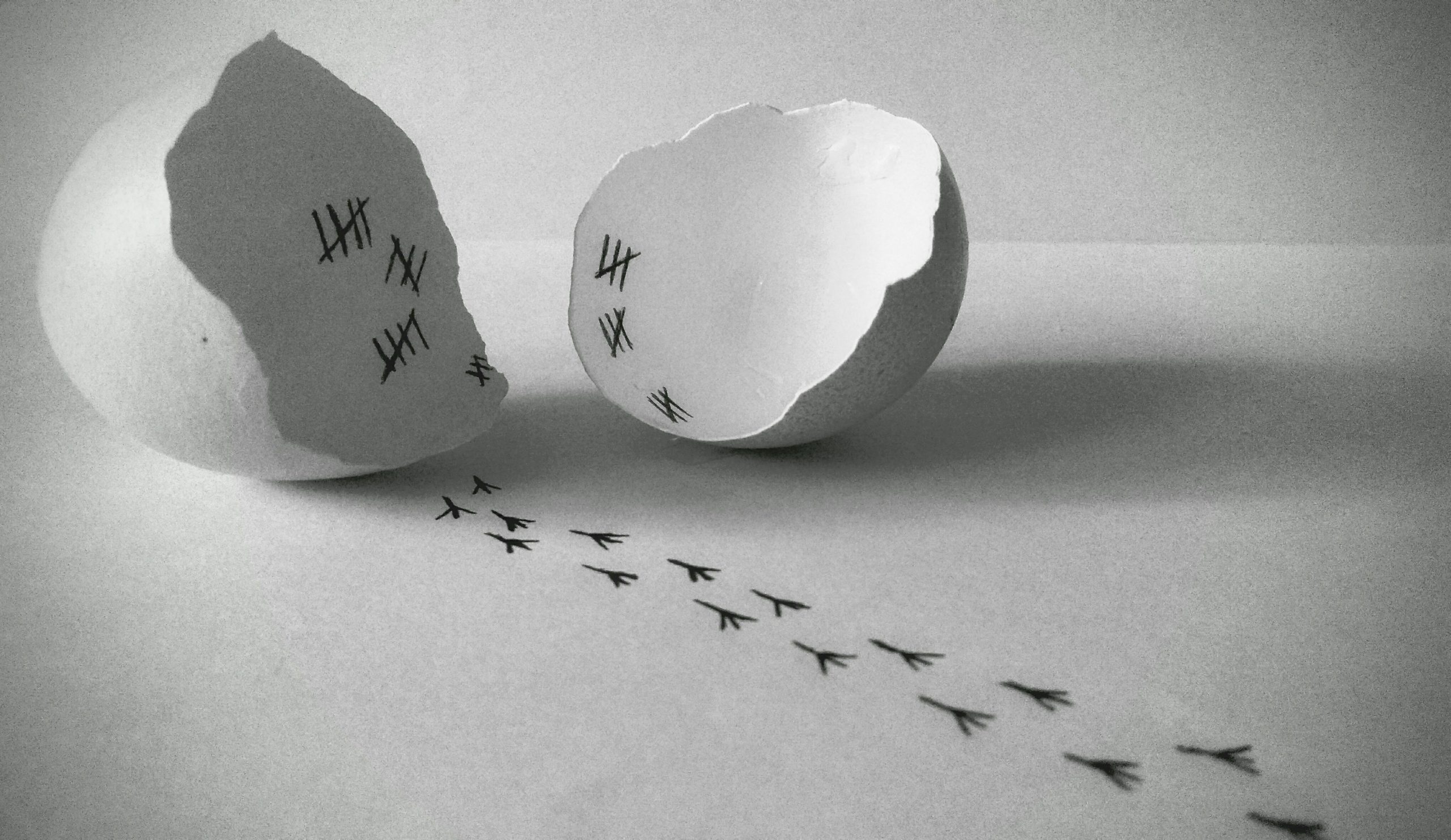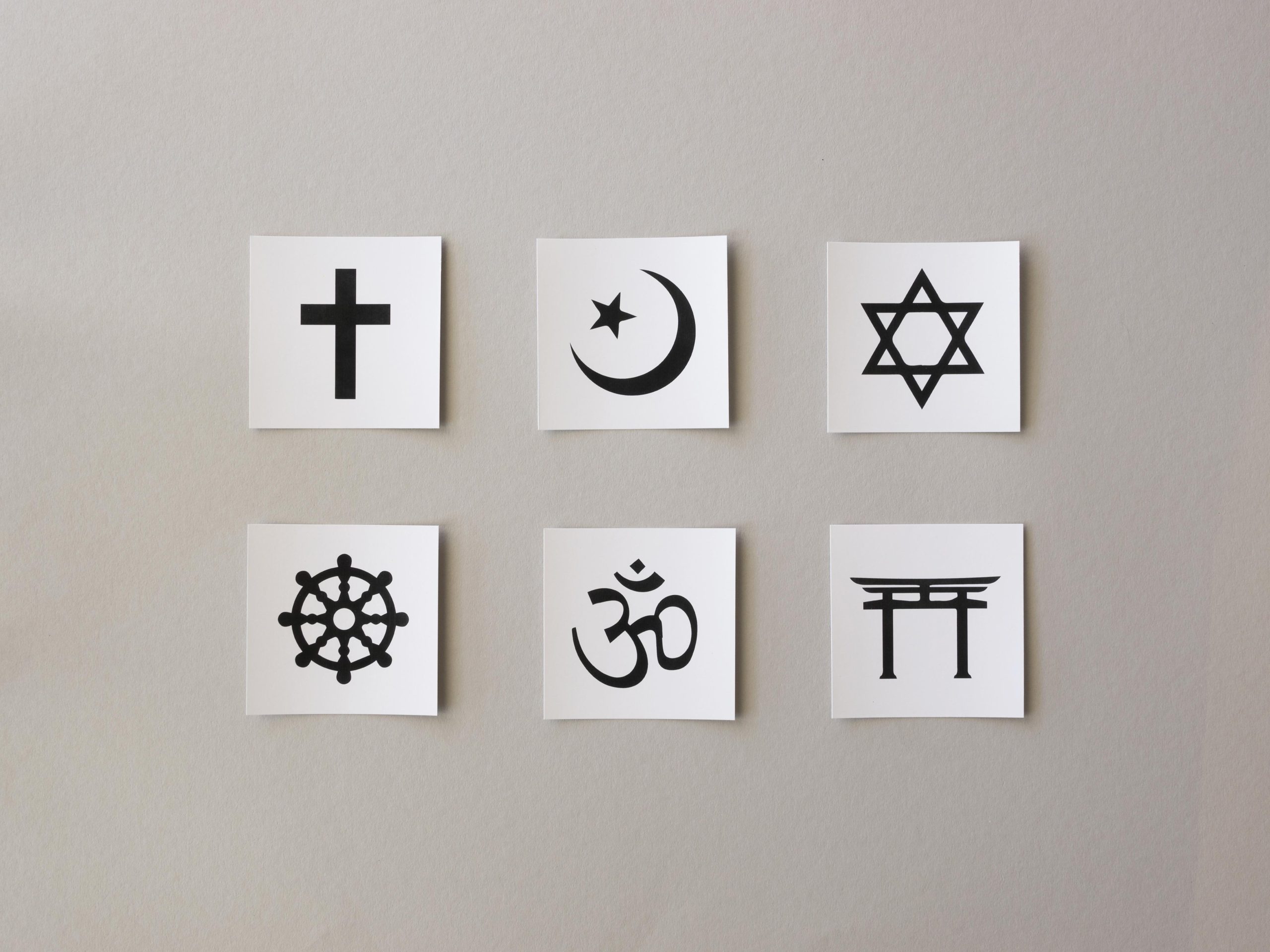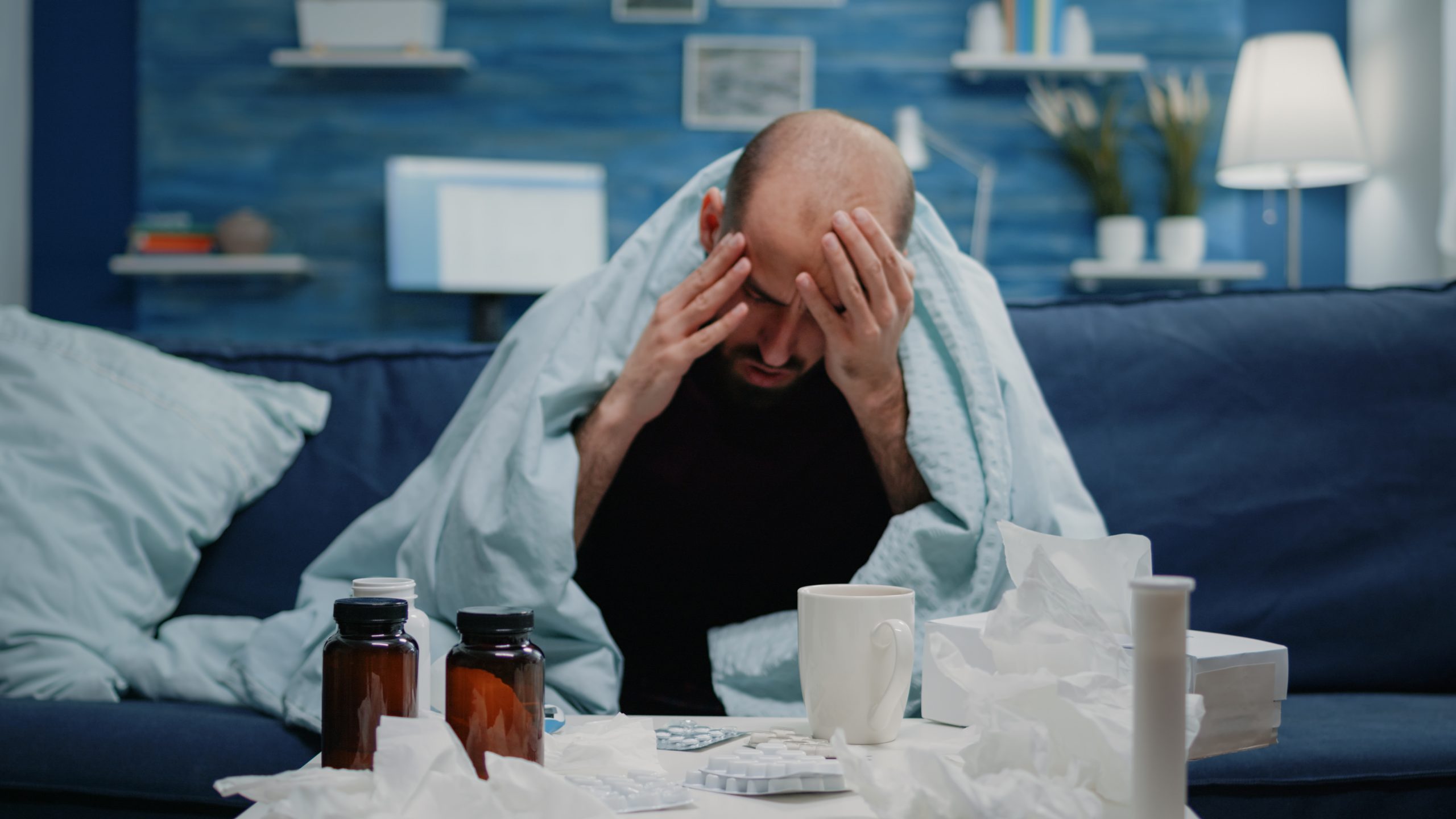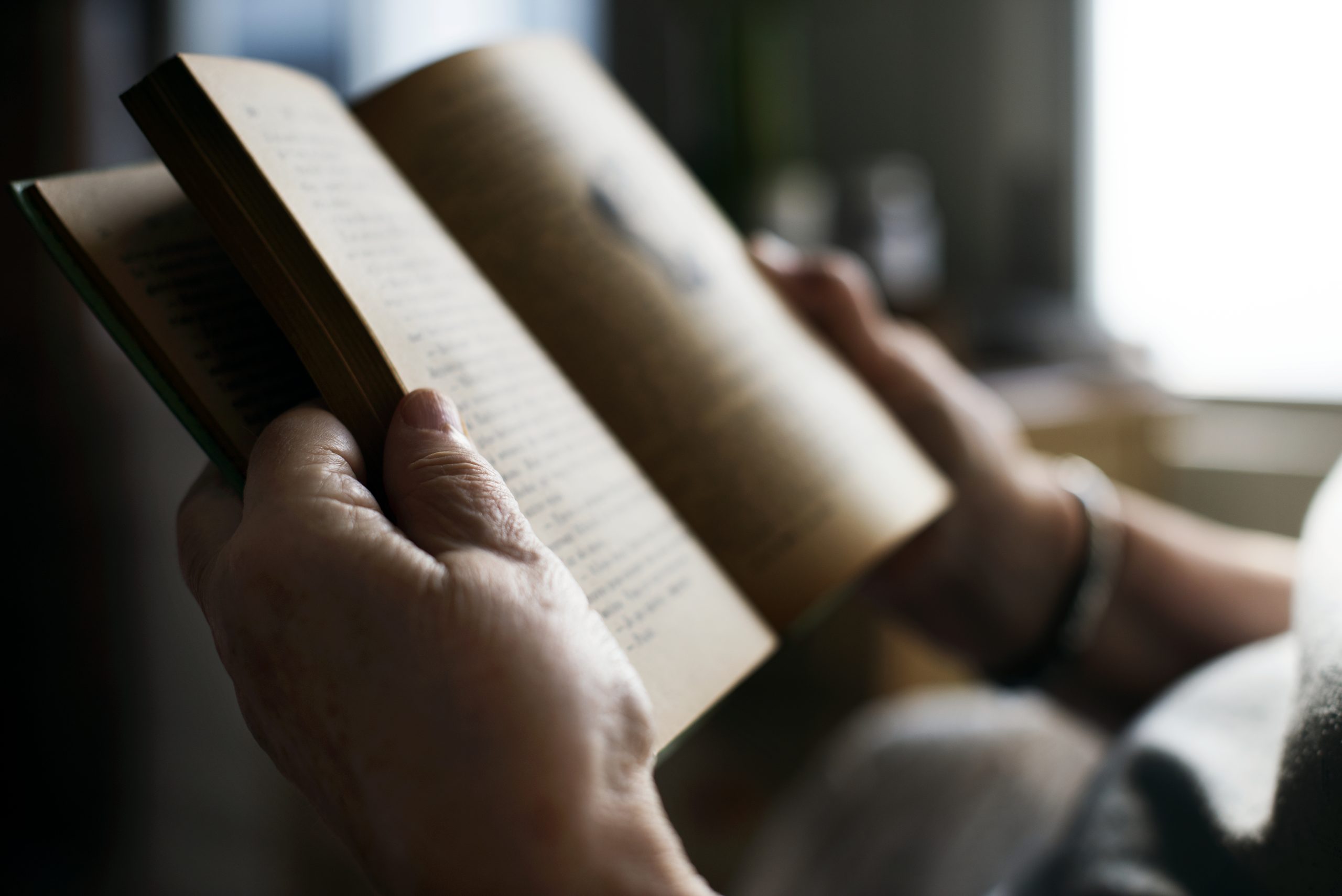10 Tabuthemen im Job: Was Sie besser nicht ansprechen sollten.
Viele predigen Offenheit, Echtheit und Klarheit. Doch was bedeutet das konkret? Bedeutet es, dass man im Pausenraum hemmungslos über Politik, das letzte Röntgenbild oder das Gehalt der Kollegin reden soll? Wohl kaum.
Im Gegenteil: Der Grat zwischen aufrichtiger Kommunikation und unprofessionellem Überschreiten sozialer Grenzen ist schmal und wird häufig fahrlässig wie auch gefährlich unterschätzt. In Zeiten von flachen Hierarchien, Co-Working-Spaces und Slack-Kanälen braucht es mehr denn je ein feines Gespür dafür, was in ein Gespräch gehört und was besser unausgesprochen bleibt.
Nachfolgend 10 Tipps, wie leicht sich Vertrauen verspielen lässt und wie viel klüger es oft ist, zu schweigen oder bewusst zu differenzieren.
Tipp 1: Kritik wird zur Karriereklemme
Die Unzufriedenheit über eine Entscheidung in der Geschäftsleitung ist gross. Der Tonfall im Teamchat wird sarkastisch. Ein Kollege kommentiert: ‘Die da oben haben ja wieder mal keinen Plan.’ Lachen, Zustimmung, Likes. Bis zu dem Zeitpunkt sich die Welle der Kritik ungewollt weiterträgt. Ein Screenshot reicht, um diese Äusserung in ganz andere Kreise zu transportieren. Wer in internen Gesprächen über Führungspersonen, Strategien oder Strukturen ablästert, riskiert mehr als nur einen schlechten Eindruck: Er oder sie torpediert die eigene berufliche Glaubwürdigkeit.
Doch wie geht man mit Frustration über Vorgesetzte oder Prozesse um, ohne sich selbst zu schaden? Indem man Kritik vorbereitet, strukturiert und im geschützten Rahmen platziert, etwa im Mitarbeitergespräch oder in einem lösungsorientierten Meeting. Sätze wie: ‘Mir ist aufgefallen, dass XY bei vielen zu Verunsicherung führt. Gibt es dazu Klärungsbedarf?’ signalisieren Weitsicht statt Groll. Wer Kritik mitgestaltend einbringt, zeigt Führungsreife. Wer sie im Affekt hinausposaunt, bleibt auf der Stelle stehen oder verliert sogar an Boden.
Tipp 2: Politische Minenfelder im Pausenraum
Es ist Montagmorgen. Die Abstimmung vom Sonntag sorgt für Gesprächsstoff. Am Kaffeetisch entbrennt eine Debatte über Zuwanderung, Klimapolitik und Neutralität. Zwei Kollegen reden sich in Rage, der Ton wird schärfer, Augen rollen, eine dritte Kollegin steht wortlos auf und geht. Was als demokratischer Austausch begann, endet in Distanzierung und unterschwelliger Spannung im Team.
Politische Gespräche gehören zu den gefährlichsten Kommunikationsformen im Arbeitskontext. Sie berühren Weltbilder, Werte, Herkunft und Identität. Oft unbewusst. Und sie laden zu Vereinfachung, Polarisierung und moralischem Hochmut ein. Wer politische Themen im Kolleg:innenkreis anschneidet, setzt voraus, dass andere dieselbe Debattenkultur teilen. Doch viele Menschen wollen am Arbeitsplatz nicht über das Weltgeschehen diskutieren, sondern schlicht arbeiten.
Es ist legitim, Meinungen zu haben. Aber es ist ebenso legitim, sie nicht in jeder Kaffeepause zu äussern. Wer das versteht, schafft Raum für ein Arbeitsklima, das auf Kooperation statt Konfrontation basiert.
Tipp 3: Religion, die stille Grenze
Ein Mitarbeiter erzählt von seinem Pilgerweg nach Santiago, eine andere Kollegin berichtet von einer Fastenzeit-Erfahrung, während eine dritte Person peinlich berührt schweigt. Die Szene wirkt harmlos, doch sie zeigt ein Grundproblem: Religion ist nie nur Thema, sondern auch Identitätsmarker. Wer am Arbeitsplatz über seinen Glauben oder seine spirituelle Praxis spricht, macht sich selbst und andere verletzlicher, als vielen bewusst ist.
Religiöse Gespräche können als Bereicherung empfunden werden, solange sie freiwillig und respektvoll verlaufen. Problematisch wird es, wenn implizite Wertungen oder Missionierungsversuche mitschwingen. Aussagen wie ‘Ich glaube, das Leben hat einen höheren Sinn’ oder ‘Ich bete jeden Tag für innere Klarheit’ wirken harmlos können aber Kolleg:innen mit anderer oder keiner Glaubenshaltung unter Druck setzen. Auch ironische Bemerkungen à la ‘Ach, du bist einer von denen’ sind ebenso giftig wie übergriffige Bekehrungsversuche.
Die goldene Regel lautet: Religion ist ein sensibles Terrain. Wer es betreten will, braucht Feinfühligkeit, Zurückhaltung, solides Wissen und die klare Bereitschaft, bei leisestem Widerstand innezuhalten.
Tipp 4: Krankheitsgeschichten, die belasten
‘Ich war letzte Woche beim Spezialisten. Verdacht auf Rheuma.’ Ein Satz wie dieser kann Mitgefühl auslösen, aber auch Überforderung. Die Grenze zwischen Information und emotionaler Belastung verläuft oft fliessend. Gesundheitsgeschichten wirken schnell zu intim, zu detailreich oder zu dramatisch für den Arbeitskontext. Was der eine als ehrliche Mitteilung versteht, empfindet die andere als Übergriff auf ihre emotionale Komfortzone.
Auch aus juristischer Sicht sind Gesundheitsinformationen heikel. Wer unfreiwillig zu viel preisgibt, riskiert Diskriminierung oder Stigmatisierung. Kolleg:innen könnten sich unwohl fühlen, Führungskräfte in ein Dilemma geraten. Deshalb gilt: Wenn Gesundheitsthemen angesprochen werden müssen, etwa im Zusammenhang mit einer Arbeitsunfähigkeit oder einem betrieblichen Wiedereingliederungsprozess, dann klar, strukturiert und in geschütztem Rahmen. Persönliches gehört nicht in den Gruppenchat oder ins Teammeeting, sondern in ein Vieraugengespräch mit HR oder Führung oder Unternehmensleitung.
Tipp 5: Lohn ist kein Smalltalk
‘Was verdienst du eigentlich?’ Eine scheinbar harmlose Frage, die an vielen Arbeitsplätzen wie ein Donnerschlag wirkt. Lohntransparenz wird gesellschaftlich gefordert und gleichzeitig tabuisiert. Wer offen über Gehälter spricht, kann Ungleichheiten sichtbar machen, aber auch Neid, Missgunst und Konflikte säen. Vor allem dann, wenn Vergleiche gezogen werden, ohne den Kontext, etwa Berufserfahrung, Ausbildung oder Verantwortungsbereich, zu berücksichtigen.
Viele Unternehmen haben interne Mechanismen zur Lohntransparenz: Lohnbänder, Benchmarking, Reviews. Doch informelle Gespräche darüber sind oft emotional aufgeladen. Wer sich unterbezahlt fühlt, trägt Frust ins Team. Wer sich überbezahlt fühlt, schweigt oder brüstet sich. Beides ist supergiftig. Deshalb: Wer Fragen hat, stellt sie am besten gezielt im Rahmen einer Gehaltsverhandlung. Und wer Ungerechtigkeiten vermutet, sucht das Gespräch mit dem HR und sicher nicht mit der halben Abteilung.
Tipp 6: Beziehungskisten am Arbeitsplatz
Liebe am Arbeitsplatz ist keine Seltenheit, aber ihre Folgen werden oft sehr unterschätzt. Wer seine Beziehungsthemen offen am Arbeitsplatz diskutiert, gibt mehr preis, als ihm oder ihr guttut. Intimität wird zum öffentlichen Spektakel. Die Gerüchteküche brodelt und schwappt über. Noch heikler wird es, wenn Beziehungen scheitern und der emotionale Fallout im Team spürbar bleibt.
Auch harmlose Anekdoten wie ‘Mein Freund schnarcht so laut, ich schlafe kaum’ oder ‘Meine Freundin will ständig wissen, wann ich Feierabend mache’ wirken schnell zu privat. Sie verschieben die professionelle Ebene, oft irreversibel. Eine gewisse Diskretion schützt nicht nur das Paar, sondern auch das Umfeld. Wer seine Beziehung lebt, ohne sie zur Bühne zu machen, bewahrt sowohl Integrität als auch Professionalität.
Tipp 7: Die dunkle Seite der Familiengeschichten
Ein Kind in der Trotzphase, ein dementer Vater, eine schwierige Scheidung, viele Arbeitnehmende jonglieren Alltag und Belastung gleichzeitig. Doch nicht alle Geschichten gehören in den Arbeitskontext. Familiengeschichten sind emotional, tief, komplex. Wer sie am Arbeitsplatz ausbreitet, lädt das Team ungewollt mit.
Natürlich soll man nicht verbergen müssen, wenn es einem schlecht geht. Aber der Unterschied liegt in der Dosierung. ‘Ich habe gerade eine herausfordernde Phase zu Hause’ genügt meist, um Verständnis auszulösen. Wer dagegen das ganze Drama erzählt mit Tränen, Details und Klagen, überfordert sein Umfeld. Und: Wer permanent in der Opferrolle auftritt, riskiert, nicht mehr ernst genommen zu werden. Professioneller Umgang bedeutet nicht, Emotionen zu unterdrücken, sondern sie situationsgerecht zu zeigen.
Tipp 8: Humor kann zur Waffe werden
Ein Spruch hier, ein Seitenhieb da und plötzlich ist die Stimmung gekippt. Humor am Arbeitsplatz ist wichtig, ja. Aber nicht jeder Witz ist harmlos. Besonders dann nicht, wenn er auf Kosten anderer geht. ‘Na, wieder zu spät – typisch!’, ‘Deine Excel-Tabelle sieht ja aus wie Kunst’ oder ‘Lernst du heute mal pünktlich Feierabend machen?’, solche Sätze sind keine Scherze, sondern subtile Angriffe, angeblich harmlos verpackt.
Der Grat zwischen Humor und Mikroaggression ist schmal. Wer Witze über andere macht, stellt sich über sie. Das beschädigt nicht nur das Vertrauen, sondern auch das eigene Selbstverständnis im Team. Besser: Humor, der wirklich Humor ist, verbindet und nicht verletzt. Ein gemeinsames Lachen über Alltagsstress ist wertvoll.
Tipp 9: Alkohol, Drogen & andere Nebenschauplätze
‘Am Wochenende war ich so besoffen und dicht, ich weiss gar nichts mehr.’ Solche Aussagen sind in vielen Teams salonfähig und doch hochproblematisch. Sie suggerieren Sorglosigkeit, fehlende Reife oder gar Abhängigkeit. Was in Freundeskreisen vielleicht als cool gilt, wirkt im Berufsleben schnell verantwortungslos.
Vor allem in sicherheitsrelevanten oder kundenorientierten Berufen kann der Eindruck entstehen, jemand nehme seine Rolle nicht wirklich ernst. Wer seine Freizeit exzessiv auslebt, darf das tun, aber sollte nicht erwarten, dafür Applaus am Arbeitsplatz zu erhalten. Auch Drogen- oder Alkoholreferenzen wirken in professionellen Kontexten unangebracht. Wer über Substanzen spricht, öffnet Türen, die sich nur schwer wieder schliessen lassen. Also am besten schon gar nicht damit anfangen.
Tipp 10: Polarisierende Medien & popkulturelle Sprengsätze
‘Hast du das Video gesehen, das beweist, dass die Medien lügen?’ Solche Aussagen gehören nicht in die Arbeitswelt. Wer polarisierende Inhalte verbreitet, drängt Kolleg:innen in Lager. TikTok-Videos, Youtube-Dokus oder politische Memes mögen unterhaltsam sein, im Arbeitskontext stiften sie oft Verwirrung oder Unbehagen.
Zudem sind viele Inhalte algorithmisch extrem übersteuert, reisserisch und faktenarm. Wer sie unkritisch teilt, gefährdet nicht nur seinen Ruf, sondern auch den inneren Zusammenhalt im Team. Meinungsvielfalt ist wichtig, aber sie gehört in respektvolle Räume, nicht in den unreflektierten Pausenplausch. Wer Diskussionen führen will, braucht Kontext, Zeit und Konsens, nicht hirnloser Clickbait.
Reden mit Haltung. Schweigen mit Verstand
Gute Kommunikation ist eine Kunst. Besonders im Arbeitsalltag. Wer zu viel sagt, verliert Autorität. Wer zu wenig sagt, wirkt unnahbar. Die Balance ist entscheidend. Diese zehn Themenfelder zeigen, wie schnell ein Gespräch kippen kann und warum es klüger ist, sich in Zurückhaltung zu üben.
Das heisst nicht, dass man sich verstellen soll. Im Gegenteil: Echtheit ist wertvoll, solange sie eingebettet ist in Respekt, Achtsamkeit und situatives Feingefühl. Professionelles Schweigen ist keine Feigheit, sondern kluge Selbstführung. Und wer reden will, sollte wissen: Der Ton, der Zeitpunkt und das Gegenüber entscheiden, ob Worte Brücken bauen oder Gräben.