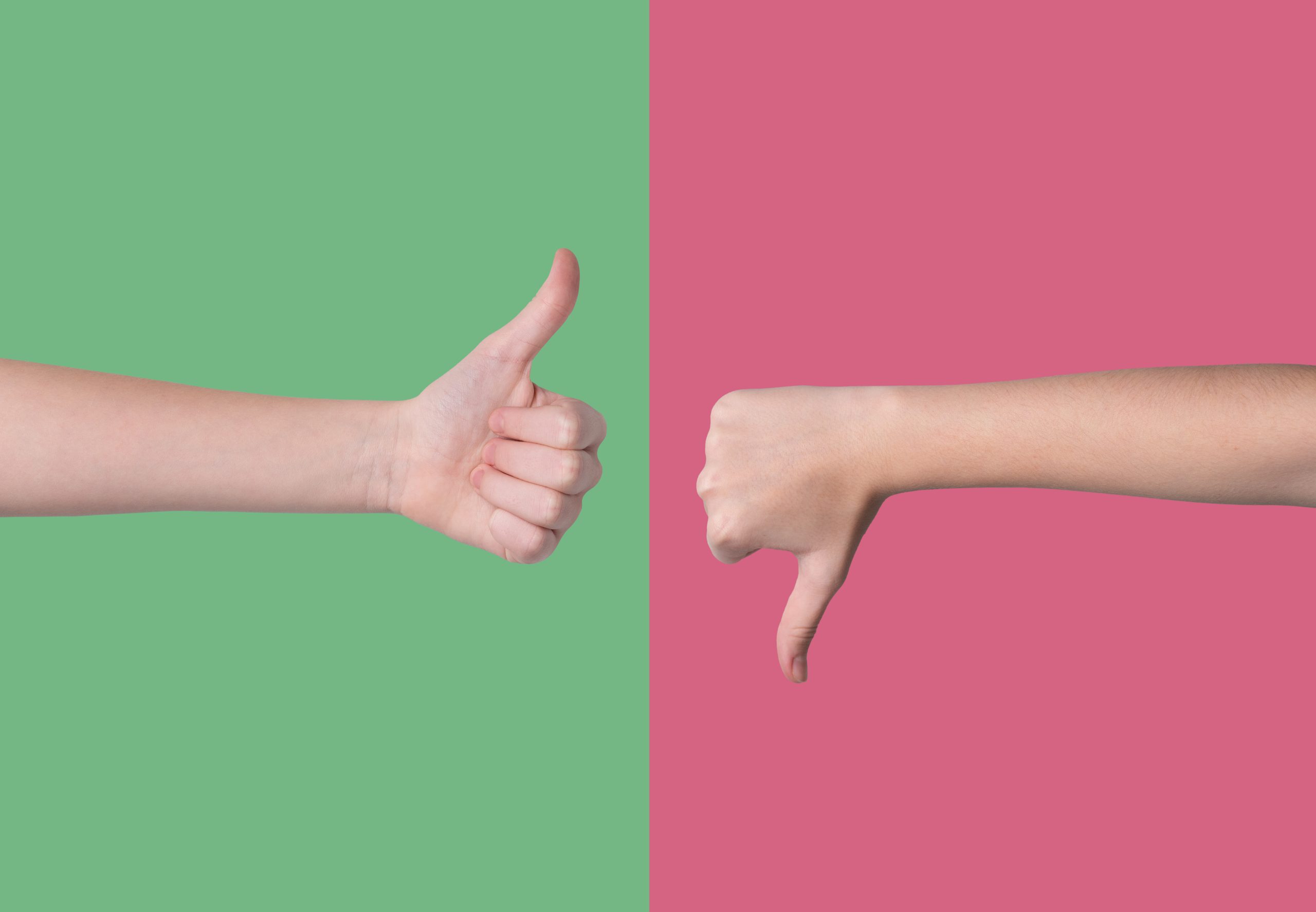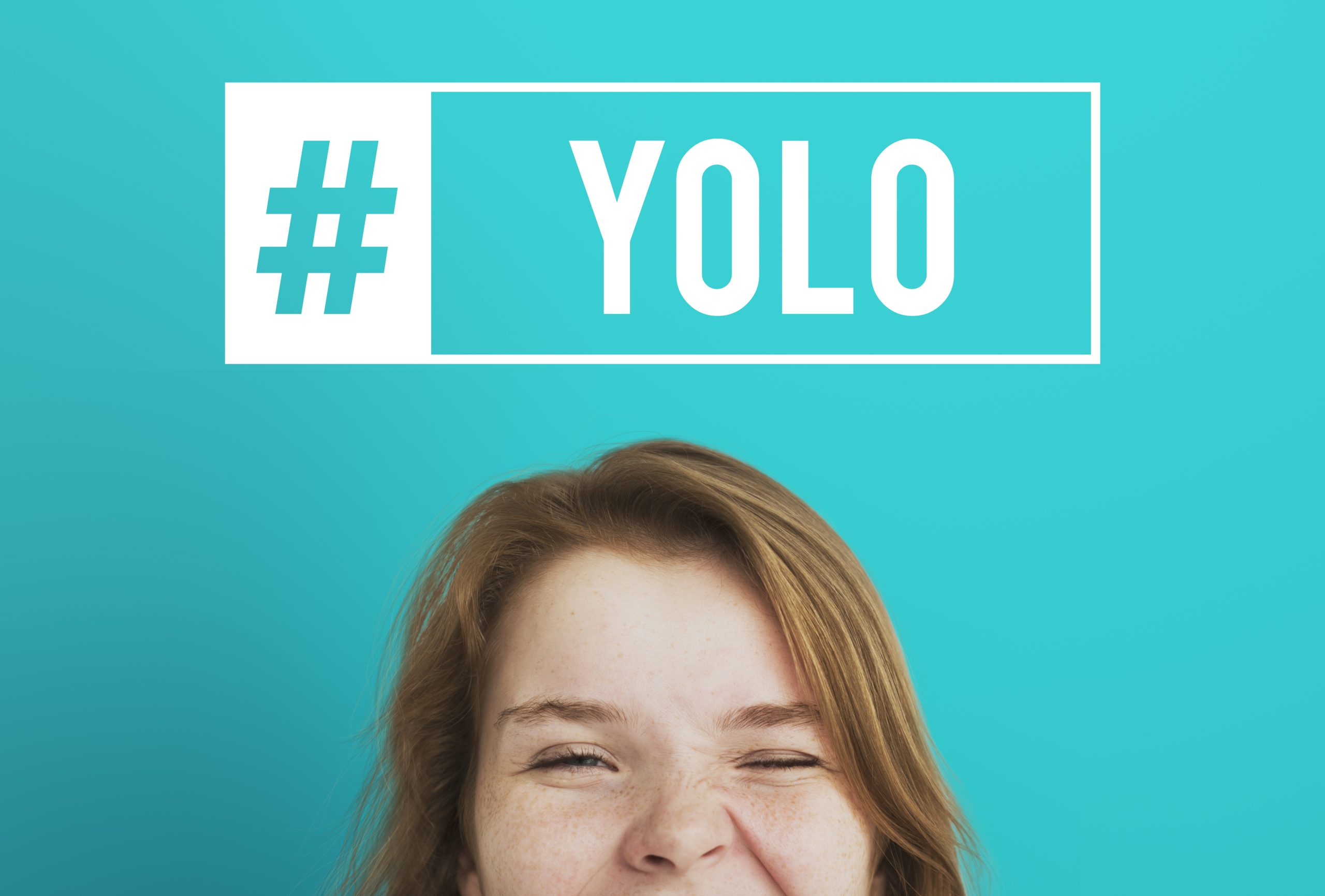Corporate-Kuschelsprech: Wie das ‘Du’ zum Zwang wurde.
Wir duzen uns. Immer öfter. In der Werbung sowieso. Im Startup ist es Pflicht, auf LinkedIn inzwischen Standard, und selbst im Bewerbungsgespräch wird zunehmend auf die formelle Distanz verzichtet.
Das kameradschaftliche und lockere ‘Du’ feiert sich als Ausdruck vermeintlicher Augenhöhe, Agilität und digitaler Coolness. Doch was bedeutet das für unser Zusammenleben, unsere Kommunikation und unser Verständnis von Respekt?
Der Niedergang des ‘Sie’ ist mehr als eine sprachliche Marotte. Er ist ein Symptom für eine tiefgreifende gesellschaftliche Entgrenzung: zwischen Hierarchie und Nähe, zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Arbeit und Freundschaft. Ist das ‘Du’ tatsächlich das neue ‘Sie’ oder nur eine sehr bequeme Ausrede, um formale, steife Strukturen zu umgehen?
Die Debatte ist alt, aber sie gewinnt mit der Zunahme digitaler Kommunikation, der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben sowie der internationalen Angleichung von Unternehmenskulturen an wachsender Brisanz. Insbesondere in der Schweiz, wo sprachliche Höflichkeit ein tief verankerter Wert ist, stellt sich die Frage nach dem Wandel mit besonderer Schärfe.
Der Sprachgebrauch ist nicht einfach neutral, sondern er transportiert Werte, Haltungen und Erwartungen.
Sprachgeschichte: Vom Respekt zur Routine
Die Entstehung des ‘Sie’ als respektvolle Anredeform ist eng mit der Herausbildung moderner Gesellschaften verbunden. Während im Mittelalter soziale Rollen strikt zugewiesen und sprachlich wenig differenziert wurden, entstand im Zuge der Aufklärung eine neue bürgerliche Sprachkultur, die auf Distanz und Reziprozität beruhte. Das ‘Sie’ wurde zum Symbol bildungsbürgerlicher Etikette, zur sprachlichen Markierung sozialer Räume und zugleich zur Möglichkeit, sich innerhalb dieser Räume respektvoll zu bewegen.
Im 20. Jahrhundert änderten sich die Normen langsam. Die 68er-Bewegung stellte Autoritäten stark in Frage, und mit ihr auch die formelle Anrede. Das Duzen wurde zum Ausdruck eines neuen Miteinanders, zur Absage an Hierarchie, Bürgermief und Standesdünkel. Doch während früher das ‘Du’ noch als rebellischer Akt galt, ist es heute zur sprachlichen Gewohnheit geworden. Die inflationäre Verbreitung dieser Anrede hat den ursprünglichen Gehalt verwässert. Was einst für sehr vertraute Intimität stand, ist nun Standard, Norm, teilweise sogar Zwang.
Zudem hat sich die soziale Funktion des ‘Du’ stark gewandelt: War es früher ein Zeichen vertraulicher Nähe, ist es heute oft ein blosses stilistisches Element, entkoppelt von echter Beziehungstiefe oder Nähe. In der Geschäftskommunikation wird es gezielt eingesetzt, um Zeit zu sparen oder Zugänglichkeit zu suggerieren, nicht um tatsächlich existierende Hierarchien abzubauen. Die historische Distinktionskraft des ‘Sie’, also die eigentliche Unterscheidung, droht dabei verloren zu gehen, obwohl sie wichtige kommunikative Funktionen erfüllt.
Gerade im interkulturellen Kontext über Sprachräume hinaus, kann diese Entwicklung zu Missverständnissen führen, wenn kulturell kodierte Formen der Höflichkeit missachtet werden. In der Schweiz, wo sprachliches Feingefühl nach wie vor sehr hochgeschätzt wird, ist dieser Verlust besonders relevant.
Der Corporate-Duzismus: Kulturwandel oder Marketingtrick?
‘Wir sind per Du, vom Praktikanten bis zur Geschäftsleitung!’, so prahlen mittlerweile unzählige Unternehmen auf ihren Karriereseiten. Was auf den ersten Blick wie eine revolutionäre Aufhebung der vorherrschenden Hierarchien klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen oft als schnöde und bedeutungslose Sprachkosmetik. Das ‘Du’ ist in vielen Fällen kein Ausdruck echter Gleichstellung auf Augenhöhe, sondern ein Werkzeug zur Emotionalisierung von Arbeitsverhältnissen. Wer duzt, kann leichter Erwartungen personalisieren: Der Ausdruck ‘Wir sind ein Team!’ bedeutet oft: ‘Gib mehr als du musst.’
Zudem spielt das ‘Du’ eine gewisse Rolle in der Employer Branding-Strategie. Es suggeriert Dynamik, Agilität, Fortschrittlichkeit und Frische. Doch häufig bleibt es bei der sprachlichen Schale ohne Inhalt. Die Entscheidungsmacht liegt selbstverständlich weiterhin bei der Führungsebene. Die informelle Sprache verdeckt eine weiterhin formale, hierarchische Struktur. So wird das ‘Du’ zum Deckmantel über einer weiterhin vorherrschende traditionellen Unternehmensrealität.
In vielen Fällen dient das ‘Du’ vor allem der Imagepflege nach aussen gegenüber Bewerber:innen, Kund:innen und Stakeholdern. Die interne Unternehmenskultur hingegen bleibt häufig sehr widersprüchlich und irgendwie kauzig: Während man auf Plakaten duzt, wird intern weiterhin stur wie auch hierarchiebewusst top-down kommuniziert. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein rhetorisches Problem, sondern untergräbt Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Du-Kultur.
Gerade junge Talente, die mit hohen Erwartungen eintreten, erleben diesen Bruch als Desillusionierung. Der mondäne ‘Duzismus’ als Feigenblatt entpuppt sich so oft genug als Bumerang für die Arbeitgebermarke und schmerzhaft eine Beule im Selbstverständnis hinterlässt. Nur weil man sich auf allen Geschäftsebenen duzt, ist man noch lange nicht wirklich modern, frisch und jung.
Psycholinguistik: Nähe ist nicht gleich Vertrauen
Sprache strukturiert soziale Realität. Das gilt insbesondere für Anredeformen, die Identität und Beziehung zugleich markieren. Das ‘Sie’ schafft unsichtbare Distanz und damit einen gewissen Schutz. Schutz vor Vereinnahmung, Schutz vor Übergriffigkeit, Schutz vor dem Missverständnis, dass berufliche Rollen mit persönlichen Freundschaften zu verwechseln sind. Das ‘Du’ hingegen suggeriert eine Beziehung, wo möglicherweise gar keine besteht. Es kann Vertrauen vorspiegeln, wo harte Kontrolle herrscht.
Vor allem in asymmetrischen Beziehungen, etwa zwischen Chef:in und Mitarbeitenden, kann das ‘Du’ plötzlich problematisch sein. Wer duzt, aber Macht hat, nimmt dem Gegenüber eine wichtige Möglichkeit zur Abgrenzung. Ein ‘“Nein’ fällt schwerer, wenn die Kommunikation auf Nähe und Harmonie getrimmt ist. Das ‘Du’ entwaffnet oft unbemerkt, aber sehr wirkungsvoll.
Zudem kann das ‘Du’ zu einem sprachlichen Erwartungsdruck führen: Wer geduzt wird, soll sich loyal verhalten, kritikfähig sein und den ‘Teamgeist’ mittragen, unabhängig von der eigenen Position. Diese Erwartung kann emotional belastend sein, vor allem wenn die tatsächliche Arbeitsbeziehung wenig Spielraum für echten Austausch lässt.
In der Schweiz, wo Arbeitsverhältnisse oft durch Sachlichkeit, Nüchternheit und Zurückhaltung geprägt sind, wirkt das ‘Du’ schnell übertrieben und anbiedernd forciert. Nicht zuletzt verunklart es die Trennung zwischen beruflicher Rolle und persönlicher Identität mit Folgen für die emotionale Selbstwahrnehmung der Mitarbeitenden. Es ist kompliziert.
Die Schweiz: Zwischen sprachlicher Vielfalt und Distanzkultur
Die Schweiz bildet einen interessanten Sonderfall. Einerseits ist sie mehrsprachig, was auch unterschiedliche Anredekulturen mit sich bringt. In der Romandie (französischsprechende Schweiz) zum Beispiel ist das ‘vous’ nach wie vor ein Ausdruck sozialen Respekts und wird auch im beruflichen Kontext kaum je in Frage gestellt. In der Deutschschweiz hingegen zeigt sich ein zunehmender Einfluss deutscher und internationaler, insbesondere angelsächsischer, Kommunikationstrends. Vor allem in urbanen Zentren und jungen Branchen (Tech, Marketing, Design) wird das ‘Du’ aktiv gefördert, teilweise sogar eingefordert.
Gleichzeitig besteht in der Schweiz eine tief verankerte Kultur der Zurückhaltung. Diskretion, Höflichkeit und das Prinzip der formellen Distanz gelten vielen als Ausdruck von Respekt und Professionalität. Wer sich dieser Tradition entzieht, riskiert nicht nur Unverständnis, sondern auch eine subtile Irritation: Warum muss man sich nähern, wenn man doch professionell bleiben könnte?
Diese Ambivalenz wird in der Praxis besonders sichtbar in der HR-Arbeit: Soll die Stellenanzeige in der Du-Form formuliert sein, um jung und dynamisch zu wirken? Oder in der Sie-Form, um Seriosität zu signalisieren? Recruiter:innen und Personalverantwortliche stehen oft vor der Herausforderung, sprachlich zwischen verschiedenen Erwartungshorizonten zu navigieren. Wer zu früh duzt, riskiert Ablehnung, wer zu spät, wirkt distanziert. Die Schweiz bewegt sich hier auf einem schmalen Grat zwischen Tradition und Moderne, zwischen Authentizität und Anpassung.
Das Du als Machtinstrument: Die Kehrseite der Vertraulichkeit
Ironischerweise wird das ‘Du’, das einst für Gleichheit stand, heute immer häufiger als subtiler Zwang empfunden. Wer in einer Firma das ‘Du’ ablehnt, gilt schnell als unnahbar, altmodisch oder arrogant. Die freiwillige Nähe wird zur stillen Norm, die man nicht mehr hinterfragen darf. Damit wird das ‘Du’ selbst zur Form der Machtausübung: Es neutralisiert Kritik durch Pseudo-Vertrautheit und erschwert die Einforderung klarer Grenzen.
Vor allem für Berufseinsteiger:innen, Praktikant:innen oder Arbeitnehmende aus anderen Kulturkreisen kann das heikel sein. Wer sich nicht traut, das ‘Du’ zu hinterfragen, verliert die Möglichkeit, formale Distanzen einzufordern, etwa im Umgang mit übergriffigen Vorgesetzten oder unklaren Rollenverhältnissen. Das ‘Du’ ist kein Garant für Vertrauen, manchmal ist es bloss ein rhetorisches Placebo, das jedoch Kopfschmerzen macht.
Diese Form von Nähe auf Kommando kann auch zu Rollenkonflikten führen. Wer ständig zwischen formeller Verantwortung und informeller Ansprache changiert, verliert nicht selten die Orientierung. Der kollegiale Ton tarnt oft strukturelle Ungleichgewichte, die so schwerer zu benennen sind. Aus HR-Sicht stellt sich hier die ethische Frage, ob das ‘Du’ wirklich freiwillig ist oder ob es zur sozialen Pflicht geworden ist, der man sich partout nicht entziehen darf. Besonders prekär wird es dann, wenn der Wechsel zum ‘Sie’, etwa bei Konflikten oder disziplinarischen Gesprächen, als gewagter Distanzbruch erlebt wird. Die scheinbare Gleichheit entpuppt sich schnell als brüchige wie auch hohle Illusion.
Was wir verlieren, wenn wir uns alle duzen
Die gesellschaftliche Tendenz zur sprachlichen Entformalisierung hat weitreichende Folgen. Wenn alles gleich klingt, verschwinden Unterschiede, auch dort, wo sie wichtig wären. Wer Kund:innen, Vorgesetzte, Fremde und Freund:innen gleich anspricht, verliert das Gespür für kommunikative Nuancen. Respekt, Höflichkeit und Diskretion geraten unter Druck, ebenso wie das Bewusstsein dafür, dass Nähe immer auch eine Frage des Kontextes ist.
Das ‘Sie’ ist kein Relikt aus vergangenen Tagen, sondern einfach ein sprachliches Instrument der Unterscheidung und der Professionalität. Es schafft einen Raum, in dem Menschen sich begegnen können, ohne sich gleich nahe kommen zu müssen. Und genau dieser Raum ist in Zeiten ständiger Selbstoffenbarung, omnipräsenter Kommunikation und permanentem Leistungsdruck kostbarer denn je.
Vor allem im Kundenkontakt, im Bildungswesen und in der Verwaltung bietet das ‘Sie’ eine wertvolle kommunikative Struktur und Stütze. Es schützt beide Seiten vor vorschneller Vertraulichkeit und wahrt professionellen Respekt. Auch in intergenerationellen Teams kann das ‘Sie’ Brücken schlagen, weil es ohne Alterskonflikte funktioniert.
In einer diversen Arbeitswelt, die auf Inklusion setzt, braucht es nicht weniger Differenz, sondern mehr sprachliches Fingerspitzengefühl. Wer pauschal duzt, beraubt sich eines wichtigen Werkzeugs zur Gestaltung sozialer Räume. Mit dem offensiven Gebrauch des ‘Du’ ist die Welt komplizierter geworden.
Zurück zum ‘Sie’ oder weiter zum bewussten ‘Du’?
Nein, das ‘Du’ ist nicht das neue ‘Sie’. Es ist einfach ein anderes Werkzeug und eines, das mit viel Bedacht und Sorgfalt eingesetzt werden sollte. Statt einer pauschalen Entweder-Oder-Logik braucht es eine neue sprachliche Mündigkeit: die Fähigkeit, Anredeformen kontextabhängig zu wählen, sie zu begründen und auch mal höflich abzulehnen.
Wer duzt, soll das mit Überzeugung tun. Wer siezt, darf das ohne Erklärungsnot unbedingt tun dürfen.
Die wahre Modernität liegt nicht im sprachlichen Gleichmachen, um es einfach allen recht zu machen, sondern im reflektierten Umgang mit sprachlicher Differenz. Denn Sprache ist nicht nur Ausdruck von Kultur, sie formt sie auch. Gerade in der Schweiz, wo Sprachwahl ein Ausdruck sozialer Intelligenz ist, lohnt es sich, das ‘Sie’ nicht vorschnell zu verabschieden. In HR-Kontexten bedeutet das: mehr Klarheit, mehr Fingerspitzengefühl, mehr Respekt vor individuellen Präferenzen. Und letztlich: mehr Verantwortung für eine Sprache, die mehr kann als einfach Nähe zu simulieren.