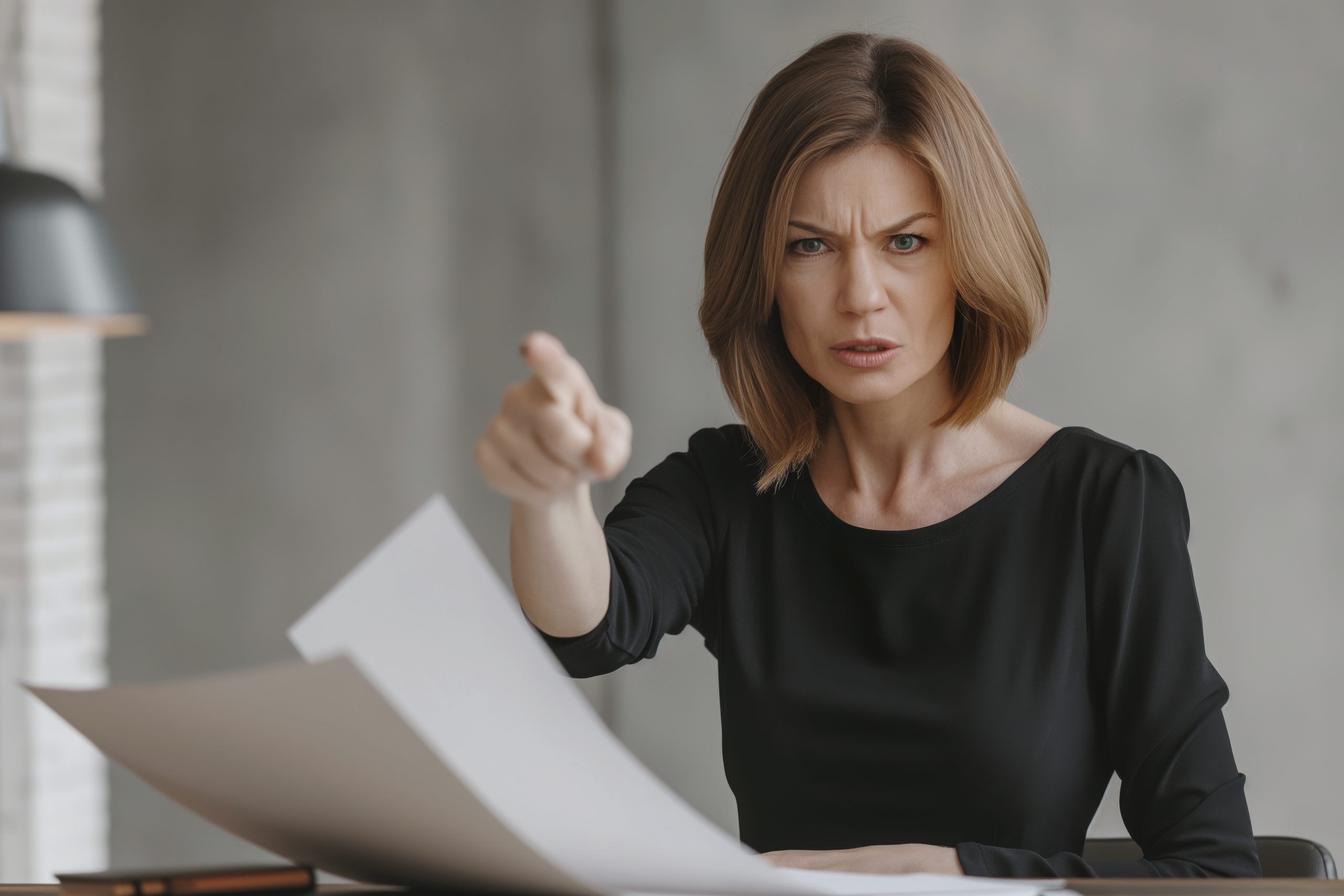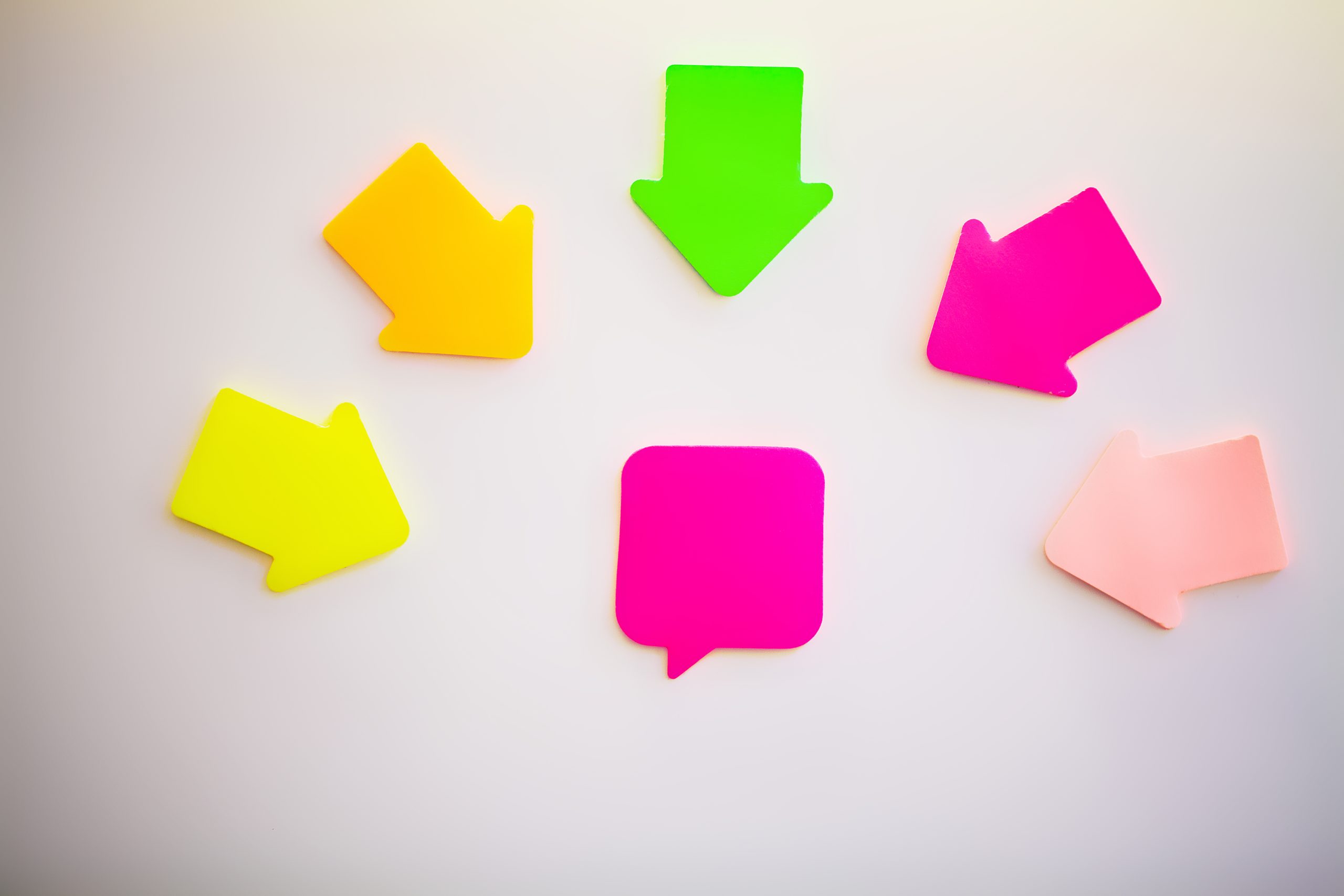Zwischen Buzzword und Bullshit: Die Sprache der Chef:innen.
Führungskräfte sind oft Meister der sprachlichen Alchemie. Sie verwandeln Unsicherheit in Autorität, Ratlosigkeit in Strategie und Bequemlichkeit in Vision.
Wer gelernt hat, ihre Worte richtig zu interpretieren, erkennt schnell: Nicht jede Phrase oder besser gesagt hohle Floskel, die freundlich klingt, ist auch freundlich gemeint. Willkommen in der Welt der Chef-Phrasen, einem toxischen Cocktail aus Buzzwords, Manipulation und semantischem Nebel.
Was auf den ersten Blick wie Führung wirkt, ist oft nur eine rhetorisch hübsch verpackte, dahin geschwatzte Blödheit.
Floskel 1: ‘Wir brauchen Macher:innen, sicher nicht Nörgler:innen!’
Klingt nach Motivation, meint aber: Kritik wird hier nicht goutiert. Wer sich traut, Dinge zu hinterfragen, läuft Gefahr, als Querulant:in abgestempelt zu werden. Der Chef will keine Diskussion, sondern oppositionslose Zustimmung im netten Outfit einer pseudodemokratischen Debatte.
Macher:innen sind hier keine kreativen Köpfe, sondern loyale und servile Erfüllungsgehilf:innen. Diese Floskel dient oft dazu, missliebige Stimmen aus Meetings zu verdrängen oder diese zum Schweigen zu bringen und eine falsche Harmonie zu erzeugen. Kritik wird gleichgesetzt mit Unproduktivität. Ein sehr gefährlicher Irrtum, denn echte Innovation entsteht nur durch Reibung. Reibung erzeugt Wärme. Und danach Feuer mit Rauch.
Wer hingegen alles abnickt, wird zwar befördert, bringt das Unternehmen aber langfristig ins seichte Mittelmass. Diese Führungshaltung erzeugt stille Organisationen, in denen alle denken, aber niemand mehr spricht. Nörgler:innen sind nicht das Problem, Führungskräfte ohne Mut schon. Deshalb sollte jede Organisation prüfen: Dürfen bei uns auch kritische Geister Macher:innen sein und ihr Unwesen treiben?
Floskel 2: ‘Ich bin offen für neue Ideen.’
Dieser Satz hat einen Ehrenplatz in der Sammlung leerer Führungsversprechens. Offen ist der Chef oder die Chefin, aber nur für Ideen, die keine Umstände machen, keine Ressourcen kosten und genau das bestätigen, was er oder sie ohnehin schon geplant hatte oder hören wollte. Kreativität ist nett wie auch willkommen, solange sie nicht stört und Sand ins Getriebe bringt.
Oft wird diese Floskel in Strategie-Workshops offensiv bemüht, um partizipative Kultur zu simulieren, während Entscheidungen längst getroffen sind. Mitarbeitende, die neue Wege aufzeigen, stossen rasch an unsichtbare Mauern aus Desinteresse, Angst oder Inkompetenz. Die Offenheit ist oft eine Einbahnstrasse: Du gibst Input, bekommst aber kein Feedback.
Wer Innovation will, muss auch bereit sein, bestehende Strukturen zu hinterfragen. Das kostet Macht. Das kostet Einfluss. Doch genau davor schrecken viele Führungskräfte zurück. So wird aus ‘offen sein’ ein naives Ritual der Innovation ohne Risiko. Dabei beginnt echter Fortschritt dort, wo Chefs nicht nur zuhören, sondern auch verändern.
Floskel 3: ‘Das gibt unser Budget leider nicht her.’
Ein Satz, der gerne reflexartig folgt, wenn es um Lohnerhöhungen, Weiterbildung oder ergonomische Stühle oder andere Aufwände geht. Ironischerweise wird derselbe Satz selten bemüht, wenn es um den neuen Geschäfts-BMW oder ein Teamevent im Fünfsternehotel geht.
Budgetklemmen gelten eben nie für alle gleich. Diese Floskel dient oft der Konfliktvermeidung, nicht der realen Kostenkontrolle. Wer sie nutzt, entzieht sich einer inhaltlichen Diskussion über Prioritäten. In vielen Fällen ist das Budget nicht das Problem, sondern der Wille zur ehrlichen Umverteilung.
Führung bedeutet auch, unangenehme Entscheidungen zu erklären, nicht sie zu verschleiern oder vor sich herzuschieben. Mitarbeitende spüren schnell, wenn Zahlen als Ausrede herhalten müssen. Vertrauen schwindet, wenn Budgetargumente beliebig erscheinen. Es braucht mehr Ehrlichkeit: Sag, dass du den Wunsch nicht priorisierst, aber verkauf es nicht als durchsichtiger Sachzwang, den alle sofort durchschauen.
Floskel 4: ‘Wir haben das schon immer so gemacht.’
Die ultimative Innovationsverweigerung. Ein Satz wie ein vergessener Betonklotz im digitalen Zeitalter. Veränderung? Ja, aber bitte nicht hier. Fortschritt? Gerne, aber bitte bei der Konkurrenz. Wer mit solchen Führungskräften arbeitet, erlebt den Arbeitsplatz als Museum, das mangels Interessen schon seit Jahren geschlossen ist.
Diese Aussage ist kein Ausdruck von Erfahrung, sondern von stumpfer Trägheit. In einer hektischen Arbeitswelt, die sich permanent wandelt, ist Stillstand kein neutraler Zustand. Er ist Rückschritt. Punkt. Mitarbeitende mit Ideen werden damit systematisch entmutigt.
Alt ist nicht immer schlecht. Wer Altes bewahrt, muss es jedoch gut begründen können, sonst ist Tradition nur Bequemlichkeit und gefährdet irgendwann die wirtschaftliche Existenz. Es braucht Mut, das Gewohnte zu hinterfragen. Und genau dieser fehlt oft in der Chefetage.
Floskel 5: ‘Ich will keine Schuldzuweisungen hören.’
Übersetzt heisst das: Die Schuldfrage ist längst intern geklärt. Und zwar zu Ihren Ungunsten. Dieser Satz ist ein rhetorischer Deckmantel, um die Sache elegant unter den Teppich zu kehren, ohne Verantwortlichkeiten offenlegen zu müssen. Schuld wird dabei nicht als funktionale Kategorie verstanden, um etwas daraus zu lernen, sondern als lästige moralische Fussnote.
In Wirklichkeit werden oft Sündenböcke gesucht. Nur eben nicht offiziell. Wer in einer solchen Kultur arbeitet, lernt schnell, dass Transparenz gefährlich ist. Fehlerkultur wird zwar gepredigt, aber nie gelebt.
Eine Führungskraft, die echte Verantwortung übernimmt, fragt nicht, wer schuld ist, sondern ganz einfach wie man gemeinsam besser wird. Doch dafür braucht es Rückgrat. Und das ist in Machtstrukturen nicht immer gleich verteilt. Bei vielen besteht es aus Gummi.
Floskel 6: ‘Sehen Sie das als Entwicklungschance.’
Das ist der Lieblingssatz, wenn man dir zusätzliche Arbeit ohne zusätzliche Ressourcen aufs Auge drücken will. Entwicklung heisst in diesem Kontext: Du entwickelst dich zu jemandem, der doppelt so viel macht wie vorher. Selbstverständlich für denselben Lohn. Diese vermeintliche Chance ist oft eine Verlegenheitslösung, weil niemand sonst die Aufgabe übernehmen will.
Wer widerspricht, hat ‘keine Ambitionen’ oder ist einfach nicht fähig. Wer mitmacht, erhält statt Anerkennung meist ungefragt weitere ‘Chancen’. Das Wort Entwicklung wird hier zur Tarnkappe für Überforderung. Wer ständig ‘Chancen’ bekommt, aber nie Ressourcen oder Lohnerhöhung, erlebt keine Entwicklung, sondern stille Ausbeutung bis zur totalen Erschöpfung.
Entwicklung heisst nicht, das Pensum stillschweigend zu erhöhen. Entwicklung braucht auch klare Perspektiven, Rückendeckung und das Recht, Nein zu sagen. Gute Führung erkennt Potenzial. Sie schützt auch vor dem Ausbrennen. Ausgebrannte Brennstäbe werden entsorgt.
Floskel 7: ‘Das Rad müssen wir nicht neu erfinden.’
Das heisst eigentlich: ‘Bitte machen Sie es genauso wie immer. Einfach schneller und billiger.’ Diese Phrase taucht oft in denselben Meetings auf, in denen Innovationen gefordert werden. Ein Widerspruch? Sicher. Aber dafür ist ja das Team zuständig, das dann mit viel energieraubender Improvisation rettet, was oben an Konzept fehlt.
Die Aussage suggeriert Pragmatismus, ist aber häufig Ausdruck von Angst vor Veränderung. Wer das Rad nicht neu erfinden will, bleibt stehen, während andere vorbeiziehen. Gerade in dynamischen Branchen ist das Festhalten an Altbewährtem gefährlich.
Innovation wird so zum Lippenbekenntnis. Der Wille zur Effizienz darf nicht zur Ausrede für geistige Trägheit werden. Fortschritt entsteht nicht durch Copy-Paste, sondern durch Neugier, Mut und Zweifel.
Floskel 8: ‘Geben Sie mir bitte nur die Bulletpoints.’
Was der Chef oder die Chefin meint: ‘Ich habe keine Zeit oder Energie, mich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Fassen Sie es für mich auf Kindergarten-Niveau zusammen.’ Expertise ist sehr wohl willkommen, aber bitte häppchenweise und servierfertig.
Der Anspruch auf Übersichtlichkeit wird zur intellektuellen Ausrede. Natürlich kann man nicht alles im Detail erklären, aber wer nur die Schlagzeilen will, riskiert schlechte Entscheidungen. Tiefe braucht Zeit. Und Zeit ist in der Chefetage oft die knappste Ressource, obwohl sie die teuerste Verantwortung trägt.
Wer alles auf Bulletpoints reduziert, reduziert auch die Komplexität der Welt. Entscheidungen brauchen Kontext. Und Vertrauen heisst auch, sich auf das einzulassen, was nicht in drei Zeilen passt.
Floskel 9: ‘Wir sind wie eine grosse Familie.’
Eine der gefährlichsten Aussagen überhaupt. In Familien gibt es emotionale Erpressung, ungelöste Konflikte, Schuldgefühle und Feiertage mit Schweigen. Genauso ist es dann am Arbeitsplatz auch. Nur ohne Geschenke, Umarmungen und Küsse. Diese Aussage romantisiert Abhängigkeit und verschleiert Hierarchien.
In der Familie verzeiht man, weil man sich liebt. Im Job soll man verzeihen, weil man keine Wahl hat. Das Konzept ‘Familie’ am Arbeitsplatz erzeugt moralischen Druck: Wer sich abgrenzt, gilt als illoyal. Wer sich wehrt, stört das Klima. Dabei braucht ein gesundes Arbeitsumfeld professionelle Distanz, klare Rollen und transparente Kommunikation.
Kein paternalistisches, flauschiges Kuschelmanagement. Wir arbeiten zusammen. Wir sind keine Familie. Und das ist verdammt nochmal auch gut so. Die Familie haben wir zuhause.
Floskel 10: ‘Ich werde darüber nachdenken.’
Ein Satz, der klingt wie Hoffnung oder Drohung und endet meist in der mentalen Abstellkammer des Chefs oder der Chefin. Wer auf echte Rückmeldung wartet, wartet lang.
Am besten gleich mitliefern: die Idee, das Konzept, die Umsetzung und den Applaus. Diese Phrase ist oft ein höflicher ‘Abwimmel-Mechanismus’. Sie signalisiert Interesse, wo keines ist. Wer sich ernsthaft mit Vorschlägen befasst, kommuniziert aktiv, sicher nicht passiv.
Ein ehrliches Nein ist oft hilfreicher als ein zögerliches Vielleicht. Nachdenken ohne Rückmeldung wird zur Hinhaltetaktik. So geht Vertrauen verloren. Führung bedeutet nicht nur zuzuhören, sondern auch Entscheidungen zu treffen und sie letztendlich zu kommunizieren.
Floskel 11: ‘In diesen volatilen Zeiten …’ Hä?
Das ist der wundervolle Klassiker aller Nebelgranaten. Wann genau waren die Zeiten eigentlich nicht volatil oder in Bewegung? Diese hohle Phrase dient als universelle Ausrede für alles: keine Gehaltserhöhung, keine neuen Leute, kein Plan. Schuld sind stets die Umstände, nie die Entscheidungsmacher:innen.
Es ist ganz einfach ein sprachlicher Rettungsanker für Führungskräfte, die sich vor unangenehmen Entscheidungen drücken. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, verweist man auf globale Unsicherheiten, die niemand konkret fassen kann. Volatilität wird zur Rechtfertigung für Stillstand, für fehlende Strategie, für Zögern.
Dabei bräuchte es gerade in instabilen Zeiten mehr Klarheit, mehr Mut und mehr Führung. Wer sich hinter der Weltlage versteckt, zeigt nur, dass der Gestaltungswille fehlt. Gute Führung macht sich nicht kleiner als die Umstände. Sie wächst an ihnen. Es braucht Mut, es braucht Durchhaltewille und manchmal auch die Fähigkeit mal auf die Zähne beissen zu können. Die Welt ist kein Ponyhof. Aber volatil.
Floskel 12: ‘Da sind mir leider die Hände gebunden.’
Dieser Satz ist das verbale Gegenstück eines Schulterzuckens in Massanzug. Sie soll vermitteln: ‘Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht.’ In Wahrheit will man nicht und schiebt die Verantwortung feige weiter nach oben. Sie ist die elegante Form des Desinteresses.
Wer sie äussert, gibt sich machtlos, obwohl er oder sie es oft gar nicht ist. Denn selbst in hierarchischen Organisationen gibt es Handlungsspielräume. Und wer sie nicht nutzt, sondern sich als Opfer der Umstände inszeniert, betreibt Scheinfürsorge.
Diese Art von Passivität erzeugt Frust und Desillusionierung im Team. Wer hingegen ehrlich sagt: ‘Ich entscheide mich dagegen’, übernimmt Verantwortung. Und das ist allemal glaubwürdiger als die gespielte Ohnmacht.
Floskel 13: ‘Wir müssen effizienter werden.’
Was folgt: Mehr Arbeit, weniger Pause, engere Deadlines. Effizienz bedeutet oft: Du machst jetzt drei Jobs gleichzeitig, während dein:e Chef:in darüber philosophiert, wie inspirierend Lean Management sein kann.
Diese Aussage kündigt selten strukturelle Verbesserung an. Sie kündigt Belastung an. Es geht nicht um echte, vertiefte Prozessoptimierung, sondern um das kalte Auspressen stiller Reserven. Der Begriff Effizienz wird benutzt wie ein Skalpell, nur dass es keine Operation gibt, sondern nur einen Kahlschlag.
Wer Effizienz fordert, ohne Prozesse zu analysieren, meint eigentlich: Arbeitet gefälligst mehr, aber ohne zu meckern. Das ist kein Fortschritt, das ist moderne Ausbeutung. Echte Effizienz beginnt bei klaren Zielen, klugen Tools und guten Rahmenbedingungen. Alles andere ist Heuchelei im Businessanzug. Und die kostet am Ende mehr, als sie spart.
Floskel 14: ‘Wir setzen auf Selbstverantwortung.’
Klingt fortschrittlich, ist aber meist ein Synonym für: ‘Mach’s allein und wenn’s schiefläuft, bist du schuld.’ Selbstverantwortung ist toll, wenn sie nicht zur Selbstüberforderung wird. Viele Führungskräfte nutzen das Prinzip, um sich selbst aus der Verantwortung zu schleichen.
Es geht nicht um Empowerment und Entwicklung, sondern um Delegation ohne Rückhalt. Wer keine Unterstützung bietet, aber Verantwortung abgibt, betreibt moralisches Outsourcing. Dabei ist Selbstverantwortung nur dann sinnvoll, wenn sie mit Vertrauen, Ressourcen und Rückendeckung einhergeht.
Ohne das wird aus Selbstverantwortung eine Falle. Die Mitarbeitenden stehen dann alleine da und die Führungskraft sagt: ‘Ich dachte, du wolltest wachsen.’ So wird Persönlichkeitsentwicklung zur Tarnung für Rückzug. Und das ist weder fair noch professionell.
Floskel 15: ‘Ich schätze Ihr Engagement.’
Dieser Satz bedeutet selten Anerkennung. Er ist meist das freundliche Ankünden zum nächsten Belastungspaket. Wer zu engagiert ist, bekommt mehr Arbeit. Gratulation. Sie sind jetzt systemrelevant.
Diese Art von ‘Wertschätzung’ ist keine Anerkennung, sondern ein Hinweis: Du funktionierst gut, also nutze ich dich weiter aus. Engagement wird als selbstverständlich betrachtet, nicht als leistbare Ausnahme. Der Satz dient dazu, Mitarbeitende bei Laune zu halten, während man ihnen Stück für Stück mehr an Verantwortung auflädt.
Dabei wird selten gefragt, ob der Einsatz nachhaltig ist. Hauptsache, die Leistung stimmt. Wer wirklich Engagement schätzt, fragt auch nach Grenzen. Und schützt sein Team vor Selbstausbeutung. Alles andere ist Manipulation im höflichen Gewand.
Floskel 16: ‘Wir brauchen mehr Teamgeist.’
Heisst konkret: Du sollst auf deine Ferien verzichten, ein Projekt übernehmen, das niemand will, und dabei lächeln. Teamgeist ist das Zauberwort, wenn individuelle Grenzen zugunsten kollektiver Ausbeutung überschritten werden sollen. Wer widerspricht, gilt als Egoist, wer sich fügt, als superloyal. So simpel ist die Logik.
Dabei wird echter Teamgeist nie verordnet, sondern entsteht durch Vertrauen, Fairness und gemeinsame Werte. Führung, die Teamgeist einfordert, aber selbst keine Solidarität lebt, demaskiert sich selbst. Wenn Mitarbeitende mit dieser Floskel zu unliebsamen Aufgaben überredet werden sollen, ist das kein Teamgeist, sondern Gruppenzwang.
Der Begriff wird zum Moralin, mit dem die Belegschaft gefügig gemacht wird. Dabei ist wahres Teamplay nur dann möglich, wenn auch individuelle Bedürfnisse respektiert werden. Wer dauernd den Teamgeist beschwört, unterdrückt oft die Stimme des Einzelnen. Und das ist alles, nur kein gesunder Teamspirit und nordkoreanische Zustände.
Floskel 17: ‘Das hat Potenzial!’
Wenn Vorgesetzte das sagen, solle man alarmiert sein. Potenzial heisst: Noch nicht gut. Noch nicht umsetzbar. Noch nicht brauchbar. Aber bitte optimieren, ohne weitere Diskussion. Der Satz ist eine charmante Art, eine Idee zu versenken, ohne sie offen zu kritisieren.
Sie entzieht sich der Klarheit, bleibt nebulös und freundlich, aber letztlich richtungslos. Wer ständig gesagt bekommt, etwas habe Potenzial, bekommt nie echte Rückmeldung. In der Unsicherheit wächst der Frust.
Dabei wäre eine klare Aussage, auch eine kritische, oft viel hilfreicher für die Entwicklung. Führung bedeutet nicht, vage zu bleiben, sondern gezielt zu fördern. ‘Potenzial’ ohne Handlung ist wie ein Versprechen ohne Absicht. Es wird nutzlos!
Floskel 18: ‘Wir denken langfristig.’
Die Vorgesetzten investieren keine fünf Franken, aber reden von Visionen 2040. Langfristig bedeutet in der Praxis oft: Du verzichtest heute auf alles, damit morgen irgendjemand anderes den Nutzen davonträgt. Vielleicht. Dieser Satz wird häufig benutzt, um kurzfristige Entbehrungen zu rechtfertigen.
Doch eine Vision ohne Verbindlichkeit ist nur ein hübscher Traum. Wer langfristig denkt, sollte auch kurzfristig handeln, sonst bleibt alles graue Theorie. Die Aussage soll strategische Tiefe suggerieren, wo oft nur Ratlosigkeit herrscht. Mitarbeitende hören sie vor allem dann, wenn sie konkrete Verbesserungen fordern.
Dann heisst es: ‘Dafür fehlt jetzt die Zeit, aber perspektivisch…bla,bla,bla’. Langfristigkeit wird zur Sedierung von Gegenwartsproblemen. Doch gute Führung agiert heute für morgen. Nicht irgendwann. Wer zu viele Visionen hat, sollte das mal medizinisch abklären.
Floskel 19: ‘Ich will keine Hierarchien. Wir sind alle gleich.’
Diese Aussage fällt häufig aus dem Mund jener Personen, die beim Apéro nicht mit dem Team am Bistrotisch stehen, sondern mit dem CEO über Synergien parlieren und angeblich Wichtiges zu sagen haben. Gleichheit endet meist an der Schwelle zur Geschäftsleitung.
Flache Hierarchien sind ein modernes Versprechen, doch oft bleibt es bei der Verpackung. In der Realität existieren Machtverhältnisse, die durch das Vokabular nur kaschiert, nicht aufgelöst werden. Wer sagt, dass alle gleich sind, aber selbst keine Kritik zulässt, meint Gleichheit nur als Rhetorik oder Sprachfüller.
Diese Phrase wird benutzt, um Hierarchie-konforme Kritik zu entwaffnen: ‘Aber du darfst ja alles sagen…’ Nein, darf man nicht. Nicht ohne Konsequenzen. Gleichheit beginnt nicht beim Titel, sondern bei echter Partizipation. Solange die Entscheidungsgewalt ungleich verteilt ist, ist Gleichheit Illusion. Und das spürt das Team.
Floskel 20: ‘Das ist eine Win-Win-Situation.’
Achtung: Win-Win heisst oft, dass dein:e Chef:in gewinnt und du nicht laut verlieren darfst. Wenn alle gewinnen, fragt man sich: Wer macht die Arbeit? Wer trägt das Risiko? Und warum fühlt es sich für dich an wie ein Spiel ohne Einsatz für andere?
Dieser Satz wird gerne bemüht, wenn man dir etwas aufschwatzen will, dass du eigentlich nicht willst. ‘Win-Win’ dient der Legitimation, nicht der Fairness. Die asymmetrische Beziehung wird durch ein symmetrisches Wort überdeckt.
Wer wirklich einen doppelten Gewinn anstrebt, fragt: Was brauchst du, damit es für dich auch stimmt? Doch diese Frage wird selten gestellt. Stattdessen wird dein Wohlgefühl vorweggenommen. Und deine Zustimmung gleich mit.
Zwischen ‚Bullshit-Bingo-Buzzword‘ und Arbeitsalltag. Was bleibt?
Nach zwanzig entschlüsselten Chef-Phrasen bleibt vor allem eines: ein bitteres Lächeln. Weil wir sie alle kennen. Weil wir sie alle schon gehört oder selbst benutzt haben. Diese Floskeln sind keine Einzelerscheinungen, sondern Symptome einer Führungskultur, die sich zu oft hinter Sprache versteckt.
Statt Klarheit, Ambiguität. Statt Verantwortung, Rhetorik. Doch Sprache ist kein neutraler Boden: Sie formt das Klima, prägt Beziehungen und schafft Vertrauen oder zerstört es.
Psychologisch betrachtet erfüllen Chef-Phrasen eine wichtige Schutzfunktion, allerdings primär für jene, die sie äussern. Sie dienen als soziale Tarnkappen, die Unsicherheit kaschieren, Konflikte vermeiden und Autorität simulieren. Wer nicht weiss, was er will, greift zur Phrase. Wer nicht sagen kann, was er meint, tarnt sich mit Worthülsen. Für Mitarbeitende hingegen wirken diese sprachlichen Manöver oft wie Gaslighting: Die Realität wird verschoben, Verantwortung verwischt, Klarheit vermieden. Das erzeugt kognitive Dissonanz. Man spürt, dass etwas nicht stimmt, kann es aber kaum greifen. Auf Dauer entsteht so ein toxisches Kommunikationsklima, das psychische Belastung zur Norm macht.
Dabei wäre die Lösung verblüffend einfach und zugleich anspruchsvoll: eine Führungskultur, die sich nicht hinter Sprache versteckt, sondern sie bewusst einsetzt. Eine Kultur, in der Worte nicht als Waffe, sondern als Brücke dienen. In der man wieder sagen darf: ‘Ich weiss es nicht.’ Oder: ‘Du hast recht.’ Oder auch: ‘Das war ein Fehler. Meiner.’ Das wäre keine Schwäche, sondern Stärke und gelebte Integrität.
Wer führen will, muss lernen, wie man redet. Und noch wichtiger: wann man besser schweigt. Die Zukunft gehört nicht jenen, die die besten Phrasen dreschen, sondern denen, die mit Haltung sprechen. Denn wahre Führung beginnt dort, wo Worte wieder Bedeutung haben.