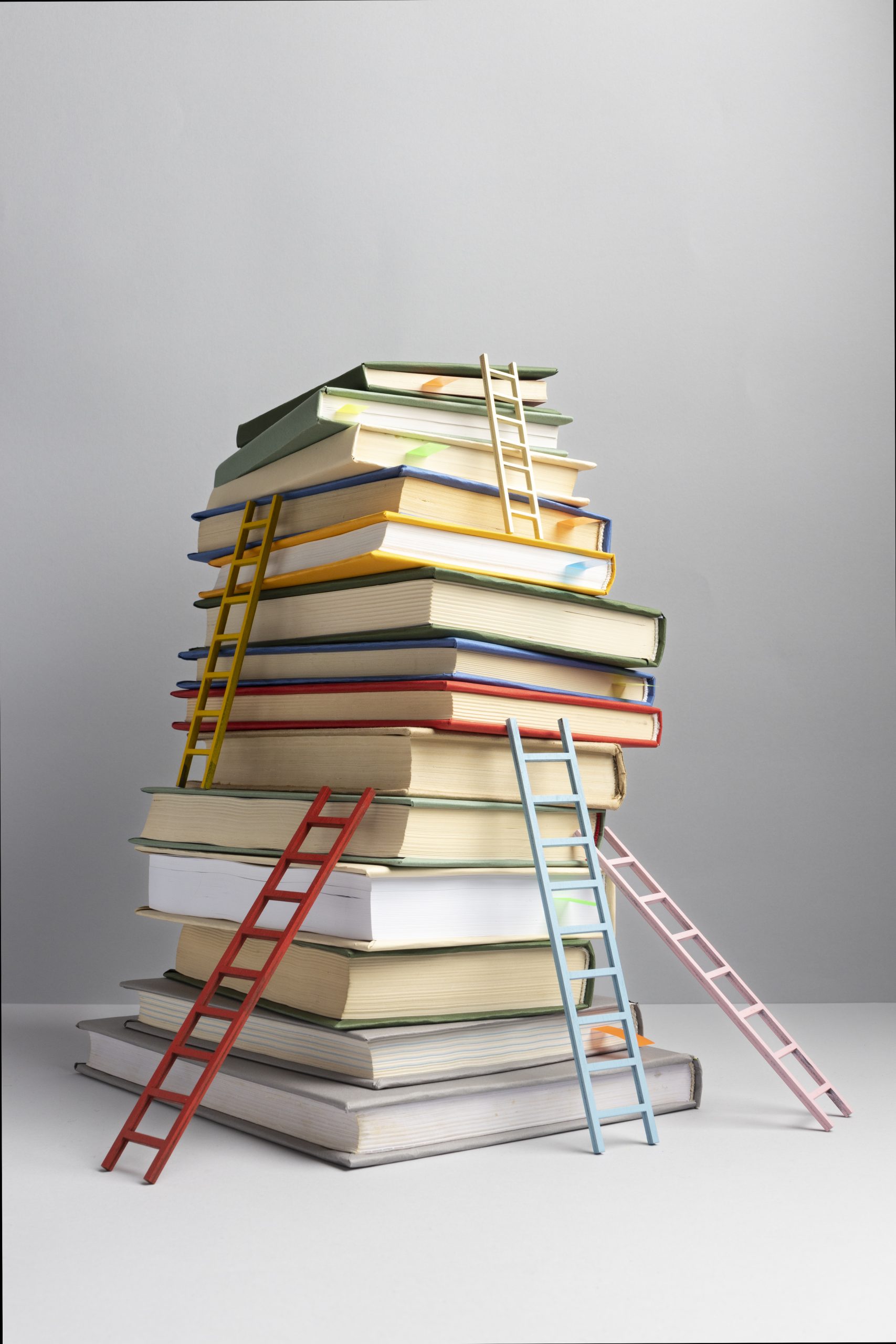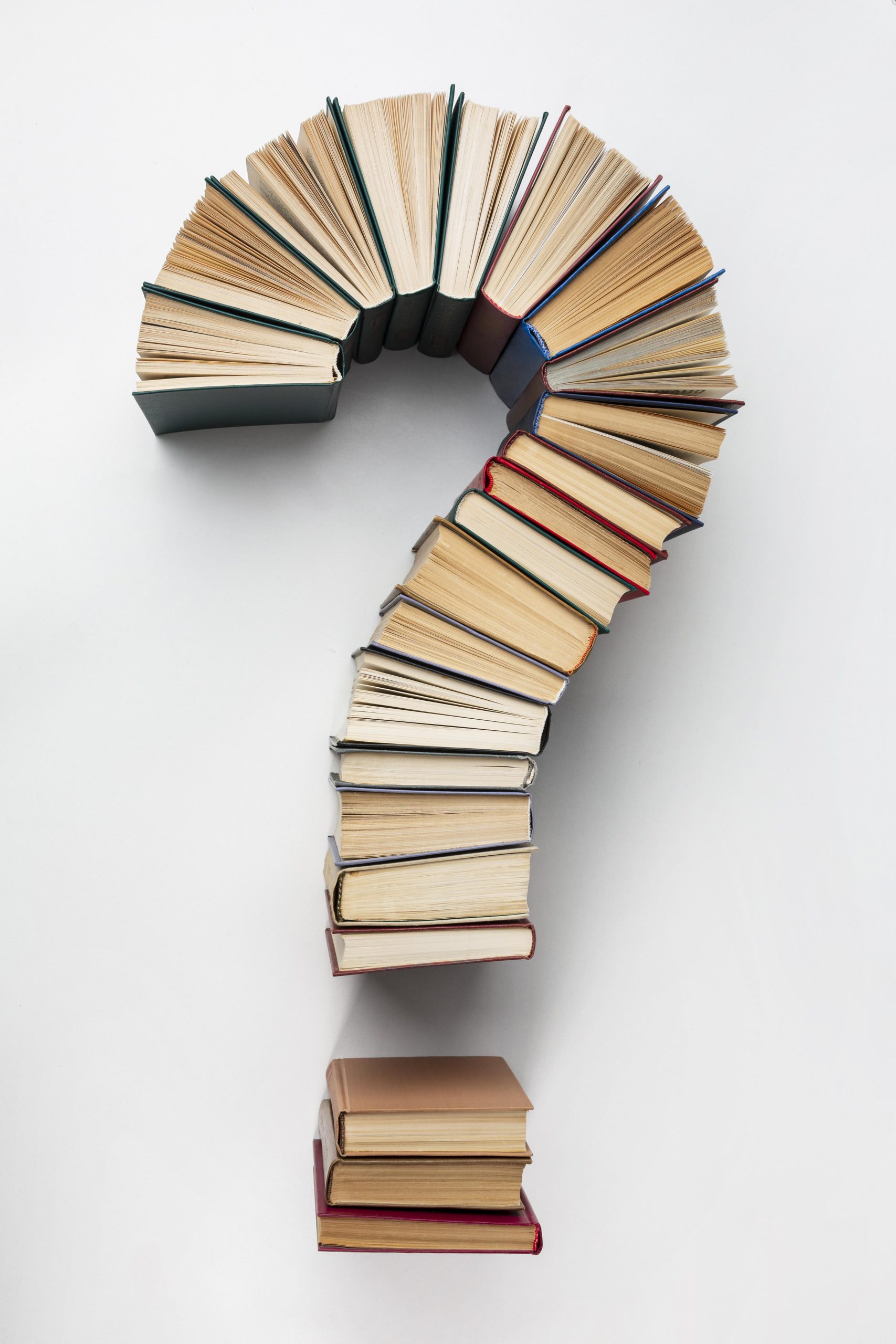Bildung ist ein Geschäft. Punkt.
Die Schweiz lernt unaufhörlich. Kaum jemand stellt das infrage. Wer nicht dauernd an sich arbeitet, gilt schnell als träge, ja fast verdächtig. Weiterbildung ist zur Selbstverständlichkeit geworden, zur stillen Pflicht der Gegenwart.
Dabei steckt hinter dieser Lernwut weniger Neugier als Nervosität. Die Schulen, Hochschulen und Seminarräume sind voll, weil draussen die Welt brüchig geworden ist. Wer sich weiterbildet, sucht Sicherheit, nicht Wissen. Der Markt weiss das. Und er bedient diese Angst mit freundlicher Effizienz.
So entsteht ein Widerspruch: Wir sprechen von Bildung, meinen aber Karrierepflege. Wir sprechen von Fortschritt, meinen aber Vorsorge. Lernen wird zur Währung, mit der man Relevanz bezahlt. Der ursprüngliche Sinn, das Staunen, das Entdecken, verschwindet leise im Hintergrund.
Ein Markt, der von Angst lebt
Die Industrie der Weiterbildung blüht, weil sie ein Gefühl kapitalisiert, das niemand gern zugibt: die Angst, überflüssig zu werden. Angst vor Automatisierung, vor neuen Technologien, vor dem Vergessenwerden. Je rascher sich die Welt verändert, desto stärker wächst das Bedürfnis nach Aufrüstung des Berufswissens. Das klingt rational, ist aber vor allem emotional.
Man kauft Seminare, wie andere Versicherungen abschliessen. Sie versprechen Schutz, falls die Zukunft einbricht. Doch Bildung, die aus Angst entsteht, ist keine Bildung. Sie beruhigt, aber sie erweitert nicht. Sie nährt die Illusion von Kontrolle, wo man sich eigentlich der Unsicherheit öffnen müsste.
Echte Bildung hat einen anderen Atem. Sie entsteht aus Staunen, nicht aus Panik. Sie verlangt Mut, Fragen auszuhalten, statt sie mit Zertifikaten zu überdecken.
Vom Bildungsauftrag zur Selbstoptimierung
‘Lebenslanges Lernen’: das klingt wie ein Versprechen, ist aber längst zur Drohung geworden. Wer nicht mitlernt, verliert. Die Idee, dass Bildung ein Recht sei, hat sich still in eine Bringschuld verwandelt. Heute steht in fast jeder Stellenausschreibung das Wort ‘Lernbereitschaft’. Es soll Offenheit signalisieren, meint aber Anpassungsfähigkeit. Lernen ist nicht mehr Selbstzweck, sondern Überlebensstrategie. Unternehmen fördern Weiterbildung nicht, weil sie an Bildung glauben, sondern weil sie bewegliche Arbeitskräfte brauchen. Man hält die Belegschaft formbar, ohne wirklich in sie zu investieren. Wissen wird taktisch verteilt, damit es wirtschaftlich bleibt.
Doch Lernen, das nur Effizienz anstrebt, verliert seine Tiefe. Bildung ist kein monatlicher Routine-Update, sondern eine innere Bewegung. Sie braucht Langsamkeit, Selbstzweifel, Stille. Bewusstsein im Lernen heisst, nicht alles zu messen, sondern manches einfach wirken zu lassen.
Die Grauzone zwischen Bildung und Geschäft
Wer heute den Überblick über den Weiterbildungsmarkt behalten will, braucht fast ein eigenes Studium. Zwischen Fachhochschulen, Universitäten und unzähligen privaten Anbietern verläuft die Grenze längst verschwommen. Begriffe wie ‘Diplom’, ‘Zertifikat’ oder ‘anerkannt’ klingen offiziell, sind aber rechtlich kaum geschützt. Jeder darf eigene Programme erfinden, eigene Titel verleihen, eigene Qualitätsstandards festlegen. So entsteht ein Wirrwarr an Versprechungen, das selbst Personalprofis oft heillos überfordert.
Das Label eduQua zum Beispiel, das gerne als Gütesiegel zitiert wird, prüft vor allem Abläufe und Verwaltung. Ob das vermittelte Wissen substanziell ist, bleibt nebensächlich. So bezahlen Menschen tausende Franken für Lehrgänge, die leider oft mehr auf Marketing als auf Inhalt beruhen. Bildung wird zur Fassade: gepflegt, zertifiziert, aber irgendwie hohl.
Wenn jeder Coach ist, ist niemand mehr Experte
Es gibt kaum ein Wort, das in den letzten Jahren so radikal entwertet wurde wie ‘Coach’. Inzwischen kann jeder einer sein, der eine Website und eine gute Geschichte hat. Damit entsteht ein grauer Markt aus Selbsterfundenen, die mit Begriffen wie ‘Mindset’,‘Purpose’, ‚Heart-centered‘, ‚Values-driven‘, ‚Conscious‘ oder ‘Führung aus dem Herzen’ hantieren. Es klingt gut, es klingt tief, aber oft bleibt es einfach leer. Zwischen Esoterik und Selbstdarstellung verschwimmt die Grenze.
Wer laut genug spricht, gilt als weise. Wer zweifelt, als unentschlossen. Doch Bildung braucht Stille, Erfahrung, und vor allem Reflektion. Wer wirklich lehrt, weiss um das, was er nicht weiss. Lernen heisst nicht, Antworten zu verkaufen, sondern Fragen offen zu halten.
Die Entwertung des Wissens
Der Bildungsmarkt hat eine neue Form der Oberflächlichkeit hervorgebracht. Man lernt immer mehr, aber immer flacher. Die Halbwertzeit verkürzt sich dramatisch. Was keinen direkten Nutzen verspricht, wird aussortiert. Philosophie, Geschichte, Kunst oder generell ausgedrückt geisteswissenschaftliche Disziplinen, all das, was das Denken dehnt und die Urteilskraft schärft, gilt als zu abstrakt. Stattdessen regieren Methoden, Modelle und Motivationsrhetorik.
Doch Wissen, das nur auf Verwertbarkeit zielt, verliert seine Tiefe. Bildung darf nicht bloss nützlich sein. Sie muss auch zweckfrei sein dürfen. Gerade das macht sie menschlich. Man kann Kompetenzen trainieren, aber nicht Einsicht. Einsicht wächst langsam, tastend, im Gespräch mit sich selbst und der Welt. Und sie hat keine Abkürzung.
Die Verantwortung der Unternehmen
Firmen könnten viel verändern, wenn sie Bildung nicht nur finanzieren, sondern auch leben würden. Doch sie bevorzugen, was sich rechnen lässt. Ein Seminar mit Abschlusszertifikat lässt sich leichter verkaufen als ein Prozess, der Bewusstsein schafft. Dabei zeigen Studien klar: Mentoring, Lernen im Team, Projektrotation oder gemeinsames Reflektieren wirken nachhaltiger als jedes standardisierte Training. Nur fehlt diesen Wissensformen das Label. Das Problem ist, dass innere Entwicklung nicht messbar ist. Aber genau das macht sie wertvoll.
Reflektierte Unternehmen erkennen: Bildung beginnt dort, wo Menschen sich trauen, Fragen zu stellen, statt bloss Ergebnisse zu liefern.
Zurück zur Substanz
Die Schweiz verdankt ihren Wohlstand einer Bildungstradition, die Denken und Handeln verband. Dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken, wenn Wissen zur Ware wird. Es braucht mehr Klarheit über Qualität, aber vor allem mehr Bewusstsein über Sinn. Kein Siegel ersetzt Gewissen, kein Diplom ersetzt Reife. Bildung geschieht leise. Sie braucht Geduld, Selbstkritik, und manchmal den Mut, nichts zu wissen. Sie ist unbequem und gerade deshalb wertvoll.
Bildung schreibt keine Karrieren, sie schärft die Wahrnehmung. Und wer klar sieht, lässt sich nicht mehr blenden. Auch nicht vom nächsten Lehrgang mit Hochglanzlogo. Die einfachste Wahrheit bleibt: Man kann sich alles Mögliche kaufen, nur nicht Verstand. Und vielleicht wäre das die eigentliche Bildungsoffensive: Menschen zu fördern, die sich nicht kaufen lassen. Weder vom Markt, noch von seinen hohlen Versprechungen.
Interne Weiterbildung: Das unterschätzte Power-Tool in Unternehmen.
Ausbildung: Der Wert von Ausbildungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt.