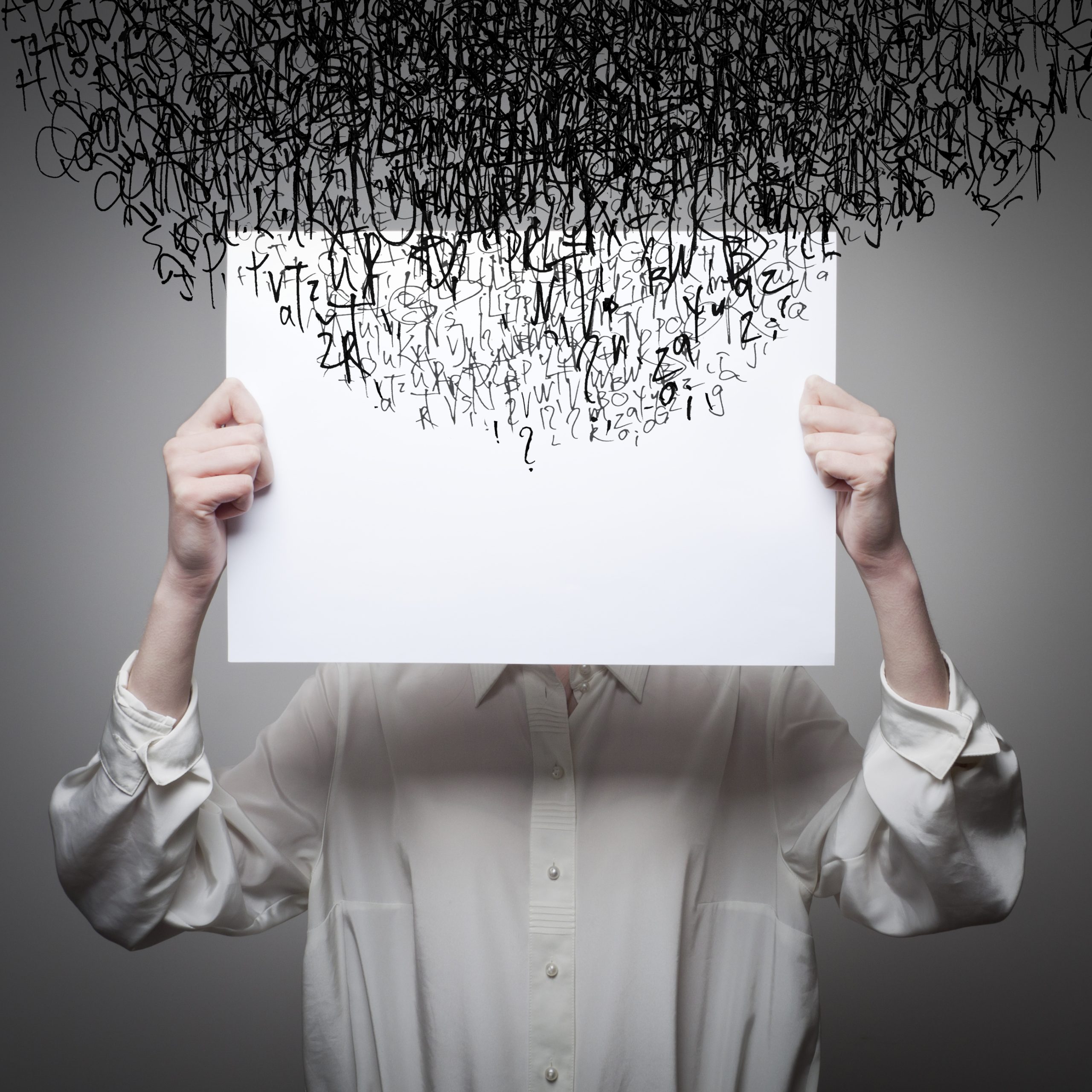Moral verkauft sich gut. Wie Kununu Profit aus Frust macht.
Es beginnt unscheinbar. Ein paar Klicks, ein Frustmoment, eine Enttäuschung. Eine Bewertung landet auf Kununu, jener Plattform, die längst zur moralischen Instanz des Arbeitsmarktes geworden ist.
Was früher vertraulich im Pausenraum besprochen wurde, steht heute öffentlich im Netz. Unwiderruflich, algorithmisch sortiert, mit Sternen versehen. Kununu hat das Verhältnis zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden grundlegend verändert. Schleichend, still, aber tiefgreifend.
Es hat den Dialog stark digitalisiert, aber nicht unbedingt verbessert. Wo früher persönliche Gespräche stattfanden, stehen heute Zahlen. Wo Vertrauen wachsen konnte, entstehen Rankings. Und doch: Kununu ist kein Unfall, sondern das Symptom einer Arbeitswelt, die sich selbst nicht mehr traut.
‘Kununu’: ein afrikanisches Wort für eine europäische Projektionsfläche
Kununu ist eine Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen und Gehaltsvergleiche. Sie wurde 2007 in Wien als eine der ersten derartigen Plattformen im deutschsprachigen Raum von den Brüdern Martin und Mark Poreda gegründet. Kununu ist Marktführer im Bereich der Plattformen für Arbeitgeberbewertungen.
Arbeitnehmer, Auszubildende sowie Bewerber in Österreich, Deutschland und der Schweiz können Arbeitgebende sowie Bewerbungsprozesse anonym über die Plattform bewerten.
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich über kostenpflichtige Employer-Branding-Profile als Arbeitgeber zu präsentieren. Der Begriff Kununu stammt aus der afrikanischen Sprache Swahili und bedeutet ‚unbeschriebenes Blatt‘ (Quelle: Wikipedia).
Der schöne Schein der Transparenz
Transparenz klingt edel, anständig und gut. Sie ist das überwertete und stark verbrauchte Modewort moderner Führung, das Feigenblatt jedes öden Leitbildes, der heilige Gral der Unternehmenskommunikation. Doch was heisst Transparenz eigentlich in einer Welt, in der Bewertungen von Algorithmen sortiert werden?
Kununu verspricht schonungslose Ehrlichkeit, doch es liefert Wahrnehmung. Die Plattform zeigt nicht, wie Arbeit ist, sondern wie sie gefühlt wird: subjektiv, selektiv, emotional. Wer zufrieden ist, schweigt meistens. Wer enttäuscht ist, schreibt oft. So entsteht eine digitale Echokammer des Extremen: Die Begeisterten loben euphorisch, die Enttäuschten rechnen brutal und schonungslos ab.
Die schweigende Mehrheit dazwischen, nämlich jene, die einfach unaufgeregt, solide arbeiten, ohne Drama, ohne Glanz, bleibt in der Regel unsichtbar. Sie ist jedoch der grosse und aussagekräftige Haufen. Sie würde die Wirklichkeit sicher und ehrlich abbilden. Sie schweigt jedoch, weil sie vielleicht kununu misstraut, die Plattform als gesichert überbewertet oder unwichtig beurteilt oder sich einfach nicht zum Affen machen will.
Die angebliche Transparenz auf Kununu ist deshalb keine objektive Offenheit, sondern eine Momentaufnahme menschlicher Emotion. Sie spiegelt das, was Menschen in bestimmten Augenblicken empfinden, nicht das, was strukturell gilt. Trotzdem wird sie wie Wahrheit behandelt. Unternehmen fürchten schlechte Bewertungen, als ginge es um rufschädigende Gerichtsverfahren. Bewerbende glauben, zwischen fünf Sternen und einem Kommentar liesse sich der Charakter eines Betriebs ablesen. Das ist selbstverständlich ein Blödsinn. Denn die Wahrheit ist komplexer. Transparenz ohne Kontext kann zur Täuschung werden. Und in einer Kultur, die Emotion mit Authentizität verwechselt, ist jedes Gefühl plötzlich ein Fakt.
Die Logik der Empörung
Digitale Räume leben nicht von Vernunft, sondern von Lautstärke und Klamauk. Das Internet belohnt jene, die übertreiben. Kununu bildet da keine Ausnahme. Es ist die Bühne für eine neue Art von moralischer Performance, in der sich Enttäuschung in Empörung verwandelt und Empörung in Wahrheit.
Ein schlechtes Bewerbungserlebnis, unfreundliche Vorgesetzte, eine angeblich ungerechtfertigte Kündigung und schon steht eine Bewertung online, scharf formuliert, emotional aufgeladen, mit dramatischem Unterton. Was früher ein gesittetes und diskretes Gespräch mit der Personalabteilung gewesen wäre, wird heute zur öffentlichen Abrechnung oder Hinrichtung.
Die Plattform ist damit nicht nur Ort des kühlen Feedbacks, sondern Bühne der dramatischen Kränkung. Und weil Algorithmen Emotionalität bevorzugen, werden die aufrichtigsten, aber leisesten Stimmen überhört. Kununu ist ein Resonanzraum für Verletzung und darin liegt seine Ambivalenz. Denn das, was Menschen dort schreiben, ist oft ehrlich. Aber es ist keine Bilanz. Es ist kruder Rohstoff, kein elaboriertes Resultat. Eine einzelne Bewertung mag authentisch sein, doch in der Summe entsteht ein Zerrbild, das zwischen persönlicher Enttäuschung und kollektiver Wahrheit verschwimmt.
Diese Dynamik ist besonders heikel in der Schweiz, wo Konflikte traditionell diskret, sachlich, indirekt und eingebettet in eine starke Konsenskultur geführt werden. Hier gilt das unausgesprochene Motto: ‘Man redet miteinander, aber man ruiniert sich nicht in der Öffentlichkeit.’ Kununu bricht mit dieser stillen Zurückhaltung. Es ist der Ort, an dem Unmut sichtbar wird, der sonst still verglüht wäre. Und vielleicht ist genau das sein eigentlicher Wert oder seine Gefahr.
Die Ökonomie der digitalen Reputation
Hinter der moralischen Fassade von Kununu steht eine wirtschaftliche Logik. Bewertungen sind nicht nur Meinung, sie sind Währung und Kapital. Wer viele positive Stimmen hat, gewinnt Bewerbende, senkt vielleicht die Fluktuation, stärkt die Marke und das unternehmerische Image. Wer schlecht abschneidet, verliert Vertrauen und damit Bewerbende, die sich für einen Job interessieren, lukrative Aufträge und vielleicht wichtige Spezialtalente, die das Unternehmen unbedingt nötig hätte.
Kununu ist längst nicht mehr bloss ein Forum, sondern ein lauter Marktplatz. Unternehmen können Premiumprofile buchen, Employer-Branding-Pakete kaufen, Feedback-Tools integrieren. Es ist die neue Währung der Sichtbarkeit. Der gute Ruf hat eben seinen Preis. Nichts ist geschenkt.
Damit aber verwandelt sich Authentizität in eine ökonomische Strategie. Unternehmen beginnen, Bewertungen aktiv zu managen. Mitarbeitende werden gebeten, ‘ehrliche’ Einschätzungen zu posten, meist kurz nach positiven Ereignissen. Kommentare werden von PR-Teams beantwortet, die jedes Wort auf Wirkung, Inhalt und Gehalt prüfen. Die scharfe Grenze zwischen Reputation und Inszenierung verschwimmt und laviert in die Beliebigkeit.
Das Resultat: eine algorithmische Donquichotterie erster Güte. Alles sieht ehrlich aus, ist aber fleissig kuratiert. Der gute Ruf entsteht nicht mehr organisch, sondern professionell orchestriert.
In einem Land wie der Schweiz, wo Vertrauen traditionell als stilles Kapital gilt, ist das eine kleine kulturelle Revolution. Früher basierte ein guter Ruf auf Taten, heute auf Ratings und Rankings. Und doch bleibt der alte Mechanismus derselbe: Vertrauen ist und bleibt das kostbarste Gut, nur dass es heute öffentlich bewertet wird.
Die Wahrheit zwischen den Zeilen
Wer Kununu liest, sieht Sterne. Wer es versteht, liest Geschichten. Zwischen den Zeilen liegen ganze Dramen des Arbeitslebens. Da schreibt eine Krankenschwester über fehlende Wertschätzung, ein Techniker über inkompetente Vorgesetzte, ein HR-Mitarbeiter über das Schweigen nach der Kündigung.
Diese Geschichten sind oft einseitig, aber sie sind real. Sie sind die Echos einer Arbeitswelt, die unter Druck steht. Viele Bewertungen handeln gar nicht von Gehalt oder Arbeitszeit, sondern von Beziehung oder ihrem Fehlen. Menschen wollen gesehen werden, gehört werden, ernst genommen werden. Wenn sie das nicht erfahren, suchen sie andere Wege. Kununu ist einer davon.
Darum ist Kununu kein digitales Schimpfportal, sondern ein emotionaler Resonanzraum. Jede Bewertung ist eine Botschaft, manchmal trotzig, manchmal verletzlich, oft unausgesprochen klug. Sie zeigt, wo Kultur nur auf PowerPoint existiert und nicht in der Realität. Wer als Arbeitgeber klug ist, liest Kununu nicht wie ein Urteil, sondern wie ein Thermometer. Es misst kein Image, sondern Temperatur. Wenn es heiss wird, lohnt sich das Hinsehen, nicht das Beschwichtigen.
Denn Bewertungen sind keine Bedrohung. Sie sind Datenpunkte menschlicher Erfahrung. Und wer lernt, sie nicht persönlich, sondern strukturell zu lesen, erkennt darin die wertvollsten Hinweise auf Kultur, Führung und Vertrauen.
Die gefährliche Macht der Anonymität
Anonymität ist der grosse Zwiespalt digitaler Kommunikation. Sie ermöglicht Offenheit, aber sie entzieht Verantwortung. Auf Kununu ist das besonders spürbar. Menschen können Dinge sagen, die sie am Arbeitsplatz nie laut äussern würden. Das ist befreiend. Aber es kann auch zerstörerisch sein.
Zwischen ehrlicher Kritik und öffentlicher Denunziation verläuft eine dünne Linie. Viele Bewertungen sind fundiert, andere sind emotional oder unfair. Manche überschreiten die Grenze zur Rufschädigung. Und trotzdem sind sie Ausdruck einer Wahrheit, wenn auch einer zutiefst subjektiven.
Kununu selbst betont, jede Bewertung werde geprüft. Doch die Kriterien bleiben unklar. Einige negative Beiträge verschwinden kommentarlos, während andere, teils offensichtlich verleumderische, bestehen bleiben. So entsteht ein Paradoxon: Eine Plattform, die Transparenz predigt, agiert selbst intransparent.
Aber vielleicht liegt das grössere Problem nicht bei Kununu, sondern in der Kultur, die es nötig gemacht hat. Wir haben verlernt, Kritik direkt zu äussern. In Unternehmen, die Feedback zwar proklamieren, aber nicht praktizieren, bleibt das Netz der letzte Ort des Aussprechens. Kununu ist nicht die Ursache der Entfremdung, es ist ihr Symptom.
Lektionen für Unternehmen
Wer Kununu als Feind betrachtet, hat den Wandel der Arbeitswelt nicht verstanden. Bewertungsplattformen sind kein Angriff, sondern ein Spiegel. Sie zeigen, wie Mitarbeitende ihre Realität erleben. Das ist wertvoller als jede Hochglanzbroschüre.
Die klügsten Arbeitgebenden reagieren nicht mit Abwehr, sondern mit Analyse. Sie erkennen Muster, wiederkehrende Themen, emotionale Untertöne. Eine Häufung von Kommentaren zu ‘fehlender Kommunikation’ ist keine Krise der Plattform, sondern ein Hinweis auf interne Strukturen und Mängel.
Der richtige Umgang mit Bewertungen beginnt mit Haltung. Keine juristische Drohung, keine hohle PR-Kosmetik, keine Floskel ersetzt ein ehrliches: ‘Danke, wir nehmen das ernst.’ Diese Worte haben mehr Wirkung als jedes schale Employer-Branding-Paket.
In der Schweiz, wo Professionalität oft mit Kühle verwechselt wird, kann solch ein Tonfall Wunder wirken. Eine offene, menschliche Antwort auf Kritik signalisiert Stärke, nicht Schwäche. Und sie schafft das, was jede Organisation am dringendsten braucht: Glaubwürdigkeit.
Lektionen für Bewerbende
Auch Bewerbende müssen lernen, Kununu intelligent zu lesen. Bewertungen sind keine Bibelverse. Sie sind Hinweise, keine Wahrheiten. Wer sie ernst nimmt, muss sie einordnen.
Kluge Bewerbende lesen zwischen den Zeilen:
- Welche Themen kehren wieder?
- Wird über Strukturen gesprochen oder über Personen?
- Sind die Vorwürfe konkret oder diffus?
Je nach Muster lässt sich erkennen, ob ein Problem systemisch oder individuell ist. Kununu kann wertvoll sein, wenn man es als Ausgangspunkt für Fragen nutzt: ‘Ich habe gelesen, dass Ihr Unternehmen an der internen Kommunikation arbeitet, was hat sich seither verändert?’ Solche Fragen zeigen Interesse, Intelligenz und Selbstbewusstsein.
Wer hingegen nur nach Sternen urteilt, verkennt die Realität. Denn kein Unternehmen ist durchgehend gut oder schlecht und schon gar nicht ein Sternenhimmel. Es gibt immer Licht und Schatten. Die Kunst liegt darin, zu erkennen, mit welchem man leben kann.
Kununu als Spiegel einer neuen Arbeitsmoral
Kununu ist kein technisches Phänomen. Es ist kulturell. Es markiert die Zeitenwende zwischen Loyalität und Öffentlichkeit, zwischen Vertrauen und Bewertung. Arbeit ist heute nicht mehr nur ein Vertrag, sondern ein moralisches Versprechen. Und Kununu ist einfach das Archiv dieser gebrochenen Versprechen.
Die Plattform zeigt, wie tief das Misstrauen in Organisationen reicht. Mitarbeitende vertrauen ihren Arbeitgebenden oft weniger als anonymen Kommentaren. Das ist erschütternd und doch nachvollziehbar. Zu oft wurden Feedbacks ignoriert, Versprechen gebrochen, Menschen nicht gehört.
Kununu ist also nicht der Auslöser, sondern das Echo einer Gesellschaft, die Beziehung durch Bewertung ersetzt hat. Wir leben in einer Feedbackökonomie, in der jede Erfahrung sofort öffentlich gespiegelt wird. Vertrauen wird gemessen, nicht gelebt.
Aber vielleicht liegt genau hier eine Chance. Kununu zwingt Unternehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es zwingt Führungskräfte, über Wirkung nachzudenken. Und es zwingt Bewerbende, sich ihrer eigenen Werte bewusst zu werden.
Zwischen Wahrheit und Wahrnehmung
Kununu ist weder ein Heilsbringer noch ein Feindbild. Es ist ein Spiegel. Einer, der uns zeigt, was wir nicht mehr sagen, sondern nur noch klicken. Bewertungen sind keine Wahrheit, aber sie sind Zeichen. Sie sind die Symptome einer Arbeitskultur, die nach Beziehung hungert und stattdessen Daten liefert. Wer sie ignoriert, verpasst Erkenntnis. Wer sie instrumentalisiert, verliert Glaubwürdigkeit. Aber wer sie ernst nimmt, kann wachsen, nicht als Marke, sondern als Gemeinschaft.
In einer Zeit, in der alles bewertet, verglichen, gerankt wird, bleibt eine Erkenntnis bestehen:
Transparenz ersetzt keine Haltung. Bewertungen ersetzen keine Werte. Und ein digitaler Stern ersetzt kein ehrliches Gespräch. Vielleicht ist das die grösste Lektion von Kununu und die unbequemste.
Der Missbrauch der Google Rezension: die digitale Bewertung als Waffe gegen Personaldienstleister.