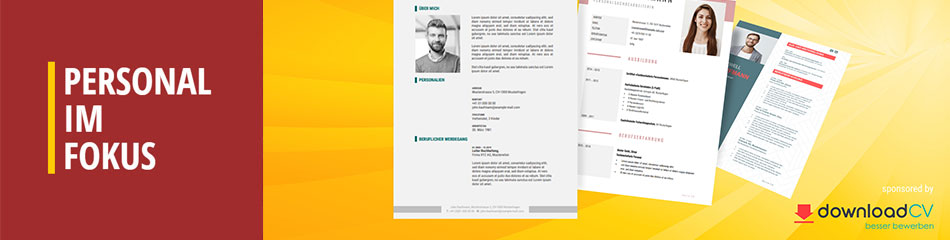Temporärarbeit zu teuer: Man hackt auf den Falschen herum.
Es gibt diesen immer gleichen Moment in Budgetrunden und GL-Sitzungen: Jemand blättert durch die Kostenpositionen, bleibt bei ‘Temporärarbeit’ hängen, runzelt die Stirn und sagt mit fester Stimme: ‘Die Temporären sind viel zu teuer. Das müssen wir reduzieren.’
Der Satz wirkt entschlossen, vermittelt Kostenbewusstsein und verschafft der sprechenden Person moralische Autorität, schliesslich verteidigt sie ja die finanziellen Interessen des Unternehmens. Nur: In dieser Pauschalität ist die Behauptung intellektuell dürftig und betriebswirtschaftlich kaum haltbar.
Wer so argumentiert, vergleicht in aller Regel Dinge, die nicht vergleichbar sind, verwechselt Lohn mit Vollkosten und blendet genau jene Risiken aus, die in einer volatilen Arbeitswelt den Unterschied machen: die Kosten der Flexibilität. Das macht die Aussage nicht nur analytisch schwach, sondern für die Personalpolitik gefährlich.
Denn dort, wo Mythen und optische Effekte den Ton angeben, geraten Einsatzbetriebe in eine Art selbstverschuldete Blindheit und steuern an den falschen Hebeln.
Was heisst hier überhaupt ‘teuer’?
Schon die Begrifflichkeit ist erstaunlich unscharf. ‘Teuer’ wogegen? Im Vergleich zu welchem Referenzwert? Bezogen auf welche Einheit: Bruttolohn, Vollkosten, produktive Stunde, FTE über ein Jahr (‘Full-Time-Equivalent’), Risikoexposition über einen Konjunkturzyklus?
In der Praxis läuft es meist so:
Man betrachtet einen Stundensatz einer temporären Fachkraft, sagen wir 55 oder 60 Franken, und stellt ihm innerlich den Monatslohn einer festangestellten Person gegenüber. Aus dem Bauch heraus wirkt der Stundensatz überzogen. Rechnet man den Monatslohn grob durch die angenommene Monatsarbeitszeit, landet man bei einem scheinbar deutlich tieferen Stundenwert. Die optische Differenz ist hergestellt, die Empörung hat ein Fundament, und das Urteil steht fest.
Betriebswirtschaftlich ist dieses Vorgehen jedoch ähnlich seriös wie der Vergleich eines Ladenverkaufspreises mit dem Fabrikpreis eines anderen Produkts, bei dem Transport, Zoll, Lager, Vertrieb und Risiko einfach unter den Tisch fallen. Der Stundensatz einer temporären Person ist ein kompletter Verkaufspreis, der sämtliche Personalnebenkosten, Verwaltung, Rekrutierung, Risiken und eine Marge bündelt. Der Monatslohn einer Festanstellung ist lediglich ein Teil dieser Kette. Wer die beiden Grössen unkommentiert nebeneinanderstellt, verwechselt Preislogik mit Kostenstruktur.
Hinzu kommt ein zweites Problem: Man vergleicht bezahlte Stunden mit produktiven Stunden. In der Lohnabrechnung sieht es so aus, als müsste eine Festanstellung nur durch die reine Arbeitszeit dividiert werden. In der Realität stehen Ferien, Feiertage, Kurzabsenzen, Weiterbildungen und Phasen geringerer Auslastung zwischen dem Lohnaufwand und der tatsächlich produktiven Zeit.
Genau dort, in dieser Lücke, verschwinden erhebliche Kosten und mit ihnen die intellektuelle Grundlage der Empörung über die ‘teuren Temporären’.
Die unsichtbaren Vollkosten der Festanstellung
Wer ernsthaft wissen will, was eine Festanstellung kostet, kommt um eine Vollkostenperspektive nicht herum. Es reicht eben nicht, den Bruttolohn zu kennen. Entscheidend ist, was das Unternehmen pro Jahr aufwenden muss, um eine bestimmte Menge produktiver Arbeitszeit zur Verfügung zu haben. Dazu gehören nicht nur Löhne, sondern auch Sozialversicherungsbeiträge, Lohnfortzahlungen, Rekrutierung, HR-Administration, Einarbeitung, Weiterbildung, Fluktuation und zeitliche Unterauslastung.
Ein Gedankenexperiment macht das greifbar. Nehmen wir eine Fachkraft mit einem Monatslohn von 6’000 Franken und einem dreizehnten Monatslohn. Der Jahreslohn beträgt damit 78’000 Franken. Konservativ gerechnet kommen darauf etwa 15 Prozent Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen hinzu, also AHV, IV, EO, ALV, Pensionskasse, Unfallversicherung und allenfalls Krankentaggeld. Das sind 11’700 Franken zusätzlich, sodass wir bei knapp 89’700 Franken landen.
Damit ist die Rechnung noch nicht zu Ende. Rekrutierung, Einführung, Dossierführung, Lohnläufe, Zeiterfassung, Planung, Personalgespräche und interne Administration sind nicht gratis. Wenn man diese Aufwände mit nur fünf Prozent auf die bisherigen Kosten ansetzt, was in vielen Organisationen eher tief gegriffen ist, erhöht sich der Betrag auf rund 94’000 Franken im Jahr.
Entscheidend ist nun die Frage, auf wie viele produktive Stunden sich diese Summe verteilt. Bei einer vertraglichen Arbeitszeit von 42 Stunden pro Woche ergeben sich theoretisch 2’184 Stunden pro Jahr. Davon sind aber in der Regel fünf Wochen Ferien abzuziehen, einige Feiertage und eine realistische Anzahl an Absenzen durch Krankheit, Arzttermine oder interne Weiterbildungen. Übrig bleiben, vorsichtig gerechnet, etwa 1’890 effektiv produktive Stunden. Teilt man die Vollkosten durch diese Zahl, liegt der Kostensatz bei knapp 50 Franken pro produktive Stunde.
Plötzlich ist der vermeintlich günstige Monatslohn gar nicht mehr so weit entfernt von jenen Stundensätzen, die im Temporärbereich oft als ‘unverschämt hoch’ bezeichnet werden. Wenn eine temporäre Fachkraft mit ähnlichem Profil etwa 56 Franken pro Stunde kostet, bewegt sich die Differenz in einer Grössenordnung von 10 bis 15 Prozent. Das ist keine Kostenexplosion, sondern eine moderate Prämie, und ein starkes Indiz dafür, dass der verbreitete Glaube an die dramatisch billigere Festanstellung vor allem ein Rechenfehler ist.
Was im Stundensatz der Temporärarbeit steckt
Wenn der Stundensatz einer temporären Person deutlich über dem umgerechneten Stundenlohn einer Festangestellten liegt, entsteht leicht der Eindruck, hier würden ‘saftige Margen’ abgeschöpft. Diese Sichtweise ignoriert, dass im Stundensatz verschiedene Komponenten gebündelt sind, die bei der Festanstellung in unterschiedlichen Budgetpositionen versteckt sind.
Zum Lohn der temporären Person kommen auch hier Sozialversicherungsbeiträge, Ferien- und Feiertagsentschädigung, Risikoprämien und die Kosten der Administration. Der Personaldienstleister finanziert zudem die Löhne vor, trägt das Inkassorisiko, investiert in Rekrutierung, Kandidatennetzwerke, Beratung und Betreuung und muss aus all dem heraus eine Marge erwirtschaften, die den laufenden Betrieb und unternehmerische Risiken deckt.
Der Stundensatz ist also nicht einfach ‘Lohn plus Gewinnaufschlag’, sondern das Preisschild auf einem komplexen Bündel aus Dienstleistung, Risikoübernahme und Verfügbarkeit. Zu diesem Bündel gehört vor allem eines: Flexibilität. Die temporäre Kapazität wird in der Regel nur dann bezahlt, wenn sie effektiv gebraucht wird. Fällt das Volumen weg, endet der Einsatz, ohne lange Kündigungsfrist, ohne Sozialplan, ohne langwierige interne Umstrukturierung.
In stabilen Zeiten mag dieser Aspekt nebensächlich erscheinen. In einem Umfeld mit schwankender Nachfrage, unsicheren Auftragslagen oder politischem und regulatorischem Druck ist er zentral.
Flexibilität als ökonomischer Wert, nicht als frei verfügbares Nebenprodukt
In vielen Diskussionen wird Flexibilität so behandelt, als wäre sie eine Art gratis hinzubuchbares Extra, das man je nach Stimmung intern oder extern erzeugen könne. Ökonomisch betrachtet ist sie jedoch ein eigenständiges Gut, das Kosten verursacht, Risiken verschiebt und Entscheidungen strukturiert.
Temporärarbeit kann man aus dieser Perspektive als Option auf zusätzliche Kapazität verstehen. Das Unternehmen hält sich die Möglichkeit offen, schnell und gezielt auf Bedarfsschwankungen zu reagieren, ohne diese Kapazität dauerhaft in Form von Festanstellungen auf der Lohnliste halten zu müssen. Die Prämie für diese Option ist der etwas höhere Stundensatz.
Die Alternative dazu ist interne Flexibilisierung: Überstunden, verschobene Freitage, kurzfristig umgebaute Dienste, Springerfunktionen, Bereitschaftsdienste oder bewusst grosszügige Stellenpläne, die auch in ruhigen Phasen ein gewisses Übermass an Personal vorhalten. All diese Instrumente haben einen Preis, finanziell, organisatorisch und auch gesundheitlich. Überlastung führt zu Fehlern, Müdigkeit zu Unzufriedenheit, chronische Überzeit erhöht das Risiko von Burn-out, Fluktuation und langfristigen Ausfällen. Das kostet alles viel Geld.
Wenn man diese Effekte nüchtern als Kosten versteht und versucht, sie pro zusätzlicher ‘flexibler Stunde’ zu beziffern, rückt die scheinbar teure Temporärarbeit in ein anderes Licht. Der Stundensatz bildet die Flexibilitätskosten explizit ab. Die interne Lösung verschiebt sie in versteckte Zonen: in Krankheitsstatistiken, Kündigungszahlen, Leistungsabfall und verdeckte Leerlaufzeiten.
Die teuren Illusionen der internen Flexibilität
Der Reflex, ‘lieber intern zu flexibilisieren, als für Temporäre zu bezahlen’, wirkt zunächst verantwortungsvoll. Er beruht aber häufig auf einer romantisierten und einlullenden Illusion: der Annahme, interne Flexibilität sei im Wesentlichen kostenlos. Das ist naive Augenwischerei.
Überstunden sind ein gutes Beispiel. Kurzfristig scheinen sie die eleganteste Lösung zu sein. Niemand muss eingearbeitet werden, das Team kennt die Prozesse, es funktioniert. Doch dieser scheinbare Vorteil wird mit Zinsen zurückgezahlt: Überzeit ist in vielen Gesamtarbeitsverträgen und gesetzlichen Regelungen mit Zuschlägen verbunden. Sie belastet die psychische und physische Gesundheit, sie schadet der Work-Life-Balance, sie verschlechtert die Arbeitgeberattraktivität und sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sich irgendwann verabschieden.
Ähnliches gilt für interne Poollösungen. Springerinnen und Springer, die je nach Bedarf in unterschiedlichen Teams einspringen, vermitteln auf dem Organigramm den Eindruck idealer Flexibilität. In der Realität entstehen hohe Koordinationskosten, wiederkehrende Einarbeitungssituationen, Identitätsprobleme und nicht selten verdeckte Unterauslastungen, wenn das Volumen schwankt. Was auf den ersten Blick ‘clever’ wirkt, entpuppt sich bei genauerer Vollkostenanalyse oft als weniger effizient, als es das Budget vermuten lässt.
Hinzu kommt die Strategie der bewussten Überdeckung. Man plant Teams lieber grosszügig, um in Spitzenzeiten nicht in Not zu geraten. Solange die Nachfrage hoch bleibt, ist das beruhigend. Wenn sie sinkt, und das tut sie in vielen Branchen zyklisch, bezahlt man über Monate oder Jahre für Kapazität, die nicht voll benötigt wird. Diese Leerlaufzeiten werden selten als ‘Kosten der Flexibilität’ verbucht, faktisch sind sie genau das.
Vor diesem Hintergrund erstaunt, wie milde interne Flexibilitätsinstrumente beurteilt werden, während externe Flexibilität in Form der Temporärarbeit zum bevorzugten Feindbild avanciert. Rationaler wäre es, beide Optionen an denselben Massstäben zu messen, statt dem einen Modell moralischen Kredit zu gewähren und das andere unter Generalverdacht zu stellen.
Temporärarbeit als ‘Make-or-Buy-Entscheidung’
Aus Sicht der Organisations- und Wirtschaftswissenschaft lässt sich die Frage nach der Temporärarbeit als klassische ‘Make-or-Buy-Entscheidung’ formulieren. Soll Flexibilität im Unternehmen selbst ‚produziert‘ werden, mit eigenen Mitarbeitenden, Strukturen und Prozessen, oder soll sie bei einem spezialisierten Personaldienstleister eingekauft werden?
Dabei geht es nicht nur um Lohnkosten, sondern um Transaktionskosten: um Informationsaufwand, Koordination, Kontrollbedarf, Risiken und die Fähigkeit, Komplexität zu managen. Der interne Weg ist dann vorteilhaft, wenn die Firma günstiger rekrutieren, planen und steuern kann als der externe Markt. Der externe Weg ist rational, wenn der Markt aufgrund von Spezialisierung, Skaleneffekten und Risikoteilung effizienter Flexibilität bereitstellen kann, als es eine einzelne Firma vermag.
Temporärarbeit ist in diesem Sinn keine exotische Randerscheinung oder ein Notnagel, sondern Ausdruck von funktionierender Arbeitsteilung in einem komplexen Arbeitsmarkt. Spezialisierte Anbieter bündeln Rekrutierungskompetenz, reife wie auch erprobte Netzwerke, Branchenerfahrung und Administration, während Unternehmen sich auf Kernprozesse und strategische Personalplanung konzentrieren können.
Zu behaupten, diese Arbeitsteilung sei ‘per se teurer’, bedeutet, die grundlegende Logik von Märkten und Spezialisierung zu ignorieren.
Warum das Narrativ der ‘teuren Temporären’ so hartnäckig ist
Angesichts dieser Argumente drängt sich die Frage auf, warum die Idee der angeblich massiv teuren Temporärarbeit sich dennoch so zäh hält. Hier kommen psychologische und weitere Faktoren ins Spiel.
- Der Monatslohn einer Festanstellung wirkt als mentaler Anker. Er erscheint vertraut, selbstverständlich, normal. Jeder darüber liegende Stundensatz wirkt intuitiv überhöht, selbst wenn die Vollkostenrechnung längst zeigt, dass dieser Eindruck trügt.
- Zusätzlich wirkt die Sichtbarkeit: Temporärkosten sind eine gut erkennbare Zeile in der Erfolgsrechnung oder im Controlling-Report.
- Vollkosten der Festanstellung und interner Flexibilität sind über viele Konten verstreut. Was sichtbar ist, wird stark überschätzt, was fragmentiert ist, wird in der Regel unterschätzt.
Hinzu kommt der Kurzfristfokus. Eine Rechnung für temporäre Einsätze belastet das aktuelle Budget spürbar und konkret. Die Kosten von Überlastung, Krankheit, Fluktuation und Produktivitätsverlusten schlagen zeitlich verzögert und in anderer Form zu Buche. Zwischen Ursache und Wirkung steht ein Zeitverzug, der es erleichtert, den Zusammenhang zu verdrängen.
Schliesslich spielen moralische Narrative eine Rolle. Temporärarbeit wird gern mit Begriffen wie ‘Prekarisierung’ oder ‘Loyalitätsproblem’ verknüpft. Das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, schlecht gestaltete, ausbeuterische Modelle gibt es, aber es führt dazu, dass die Form der Beschäftigung moralisch vorcodiert ist, bevor überhaupt gerechnet wird.
Wer sich als Verteidigerin oder Verteidiger der fest angestellten ‘Stammbelegschaft’ sieht, positioniert die Temporären quasi automatisch auf der Gegenseite. Ökonomische Argumente werden dann nachträglich gesucht, um eine bereits gefällte moralische Wertung zu stützen.
Darüber hinaus ist die Temporärarbeit in der Schweiz durch Gesamtarbeitsverträge (GAV) streng reguliert, die nahezu alle Branchen erfassen und für die gesamte Personaldienstleistungsbranche verbindlich sind. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird von paritätischen Kommissionen, Gewerkschaften und weiteren Aufsichts- und Kontrollorganen engmaschig überwacht und konsequent durchgesetzt.
Was die Abwehr gegen Temporärarbeit über Firmen verrät
Spannend wird es, wenn man die starke Abwehr gegenüber Temporärarbeit als Symptom versteht. Häufig zeigt sich darin weniger eine seriöse Kostenkritik als vielmehr der Versuch, strukturelle Probleme zu verschieben.
Dort, wo die Personalplanung schwach ist, wo es keine klare Trennung zwischen Grundlast und Spitzenabdeckung gibt, wo Stellenpläne historisch gewachsen und politisch aufgeladen sind, wirkt jede temporäre Lösung wie ein Störfall in einem imaginären Ideal der reinen Festanstellung. Statt dieses Ideal in Frage zu stellen, bekämpft man das sichtbare Symptom.
Dort, wo Arbeitsbedingungen unattraktiv sind, wo Dienstpläne nicht planbar, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben schlecht und die Führungskultur schwach sind, steigt die Fluktuation. Personallücken werden dann zwangsläufig mit temporären Kräften geschlossen. Die Kosten der Temporärarbeit werden dramatisiert, die Ursachen im eigenen System bleiben unangetastet.
Und dort, wo politische Symbolik wichtiger ist als analytische Klarheit, wird die Reduktion der Temporärkosten zum leicht vermittelbaren Sparsignal. Dass gleichzeitig Überstunden ansteigen, Krankheitsquoten zunehmen und die Fluktuation hochgeht, wird entweder nicht wahrgenommen, nicht öffentlich thematisiert oder bewusst ausgeblendet, vor allem dann, wenn es darum geht, das eigene Wertverständnis rhetorisch aufzurüsten. In all diesen Fällen ist Temporärarbeit weniger eine Kostenursache als ein Indikator dafür, dass grundlegende Fragen von Kapazität, Attraktivität und Arbeitsorganisation ungelöst sind.
Wer die Debatte um Temporärarbeit ernst nimmt, kann sie deshalb als Spiegel nutzen: Sie zeigt, wo die eigene Personalstrategie auf dem Papier besser aussieht als in der Realität.
Temporärarbeit im grösseren Bild des Arbeitsmarktes
Betrachtet man den Arbeitsmarkt als Ganzes, wird noch deutlicher, warum Temporärarbeit nicht einfach eine ‘teure Abweichung’ vom Normalzustand ist, sondern eine Antwort auf strukturelle Spannungen. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, schwankende Nachfrage, zunehmende Überregulierung und steigende Ansprüche an Verfügbarkeit und Qualität der Dienstleistungen oder Produktion machen es immer schwieriger, alle Kapazitätsfragen über klassische Festanstellungen zu lösen.
Temporärarbeit wirkt hier als Brücke: Menschen steigen wieder ein, wechseln Branchen, testen neue Arbeitgebende, überbrücken Übergangsphasen. Für Unternehmen ermöglicht sie, auf Phasen erhöhter Nachfrage, auf Projekte, auf saisonale Muster zu reagieren, ohne dauerhafte Verpflichtungen eingehen zu müssen, die sich im nächsten Abschwung rächen würden.
Man kann diese Entwicklung kritisch sehen, sie sozialpolitisch hinterfragen und über bessere Rahmenbedingungen nachdenken. Was man nicht seriös tun kann, ist so zu tun, als wäre Temporärarbeit ein betriebswirtschaftlicher Irrweg, der sich einfach durch einen Akt des guten Willens abschaffen liesse.
In der Realität moderner Arbeitsmärkte ist sie ein Strukturphänomen, man kann sie gestalten, regulieren, verbessern, aber nicht wegmoralisieren.
Nicht die Temporären sind zu teuer, sondern überkommene Denkmuster
Am Ende läuft alles auf eine Verschiebung des Blickwinkels hinaus. Die Frage, ob Temporärarbeitende teurer sind als Festangestellte, ist falsch gestellt. Sie suggeriert, es gehe um einen simplen Kostenvergleich zwischen zwei Beschäftigungsformen, während in Wahrheit ein komplexes Gefüge aus Vollkosten, Flexibilitätsbedarf, Risiken und firmeninterne Schwächen im Hintergrund steht.
Richtig gestellt müsste die Frage lauten: Unter welchen Bedingungen ist es sinnvoll, bestimmte Teile der Kapazität über Festanstellungen abzudecken, andere über interne Flexibilitätsinstrumente und wieder andere über temporäre Arbeitsformen? Welche Kombination dieser Elemente minimiert nicht nur kurzfristige Lohnkosten, sondern auch langfristige Risiken, verdeckte Belastungen und strukturelle Dysfunktionalitäten?
Wer diese Frage ernsthaft bearbeitet, wird feststellen, dass die pauschale Behauptung ‘Temporär ist teurer’ nicht trägt. Ja, temporäre Einsätze sind pro produktiver Stunde meist etwas kostspieliger als die Vollkosten einer ideal ausgelasteten Festanstellung. Aber sie sind oft günstiger als die realen Kosten interner Flexibilisierung und allemal günstiger als die Folgekosten von Überlastung, Fluktuation und struktureller Untersteuerung.
Teuer ist nicht die Temporärarbeit an sich, teuer ist eine Personalpolitik, die mit moralischen Schlagworten und optischen Vergleichen arbeitet, statt mit Vollkosten, Szenarien und klaren Rollen für Stammbelegschaft, interne und externe Flexibilität.
Wer bereit ist, diese Denkmuster zu hinterfragen, wird Temporärarbeit nicht mehr als Feindbild brauchen, sondern als ein bewusst eingesetztes, rational bepreistes Instrument in einem Arbeitsmarkt, der sich längst von der Illusion der stabilen Vollzeit-Kernbelegschaft als einzigem Modell verabschiedet hat.
Die versteckte Ausbeutung: Temporärfirmen als Liquiditätslieferanten der Firmen.
Temporärpersonal ist kein Personal zweiter Klasse – das sagt das Bundesgericht