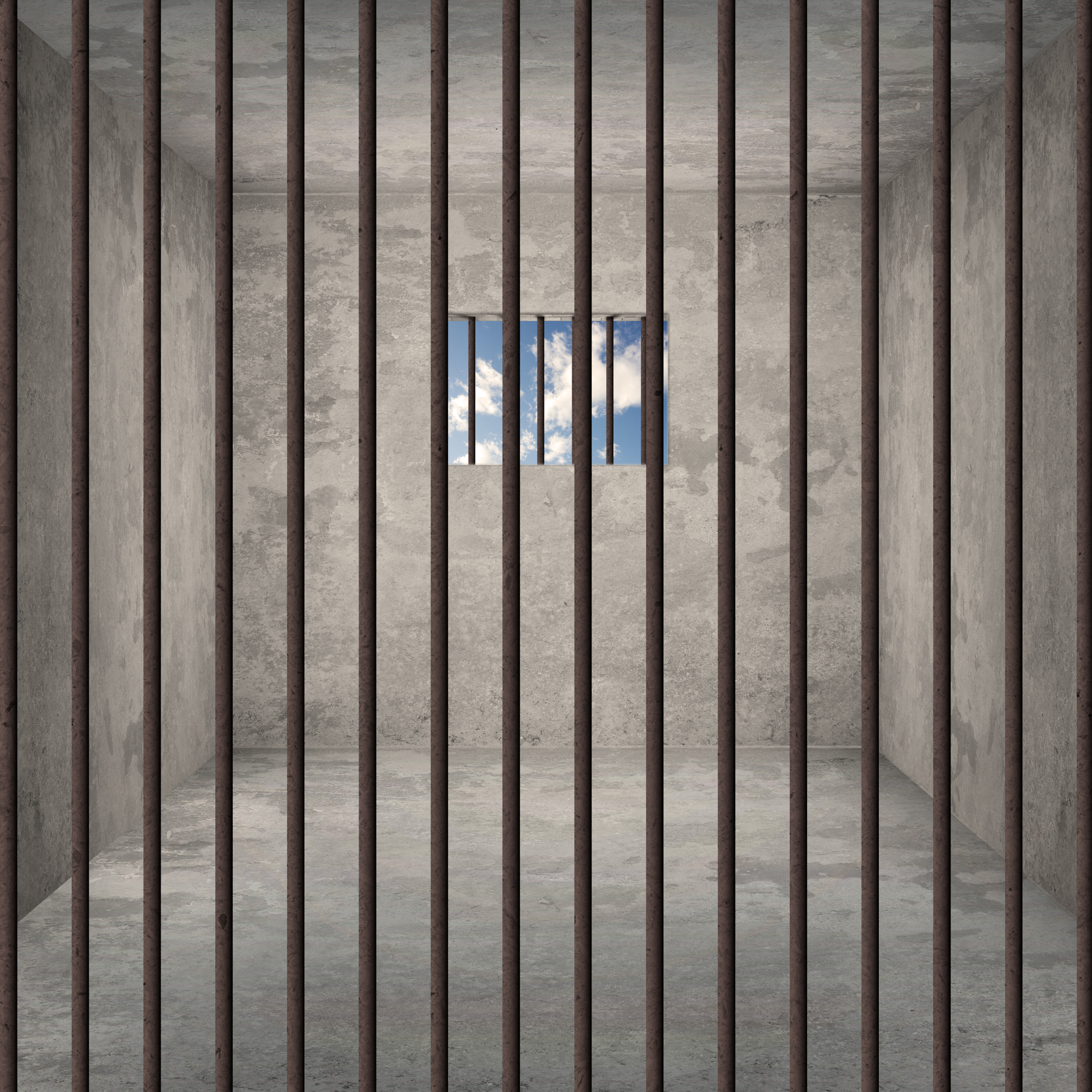Die Kündigung beginnt im Browser…
In vielen Schweizer Unternehmen gibt es einen Satz, der sich hartnäckig hält wie ein altes Firmenlogo: ‘Bei uns ist die Fluktuation tief. Unsere Leute sind loyal. Hier will niemand weg.’
Er klingt beruhigend, fast tröstlich. Er passt zum Bild des verlässlichen Schweizer Betriebs: solide, beständig, berechenbar. Nur stimmt er immer seltener. Denn die Stabilität, die wir sehen, ist oft nur die Oberfläche. Darunter bewegt sich etwas anderes: leise Zweifel, unausgesprochene Müdigkeit, heimliche Stellensuche. Nicht als Drama, nicht als offener Konflikt, sondern als stiller, digitaler Rückzug. Die moderne Kündigung beginnt selten mit einem Brief. Sie beginnt mit einem Profil-Update.
Neue Loyalität: ‘Ich bleibe, aber nicht um jeden Preis’
Loyalität im klassischen Sinn war lange eine Einbahnstrasse: Man bleibt, weil man einmal angefangen hat. Man bleibt, weil man bleiben soll. Dienstjahre als Ausweis von Tugend. Diese Logik bricht mehr und mehr still auseinander. In der Schweiz, wo Arbeitssicherheit und Einkommen für viele lange selbstverständlich wirkten, verschiebt sich etwas Grundsätzliches: Menschen bleiben nicht mehr trotz Unzufriedenheit, sondern nur so lange, wie das Gleichgewicht zwischen Belastung, Sinn, Entwicklung und Einkommen noch irgendwie tragbar ist. Die Sätze im Inneren klingen anders als früher: Nicht mehr ‘Ich kann doch nicht einfach gehen’, sondern: ‘Wie lange halte ich das so noch aus?’
Loyalität wird zur Beziehung auf Zeit. Sie muss gepflegt werden oder sie erodiert. Und diese Erosion beginnt längst, bevor jemand das Büro der Personalabteilung oder das Büro des Chefs betritt.
Innere Kündigung: Wenn aus ‘wir’ langsam ‘sie’ wird
Der eigentliche Abschied beginnt selten mit einem Paukenschlag. Er beginnt mit einem leisen Wechsel der Perspektive. Im Kopf wird aus ‘wir’ nach und nach ‘sie’: ‘Wie haben die das schon wieder entschieden?’. ‘Wieso hören die uns nie richtig zu?’. Der Betrieb wird zum Beobachtungsobjekt. Man ist noch Teil des Systems, aber innerlich bereits auf Distanz. Man erfüllt seine Aufgaben, liefert Ergebnisse, sitzt in Meetings und spürt gleichzeitig: Etwas hat sich verschoben.
Es gibt diesen Moment, den man nirgendwo protokolliert findet: Jemand sitzt abends am Küchentisch, Laptop aufgeklappt, und tippt zum ersten Mal seit Jahren in ein Suchfeld das eigene Berufsfeld plus das Wort ‘Stellen’. Kein grosser Entschluss. Kein Trotz. Nur ein vorsichtiges Austesten: Was gäbe es denn sonst noch?
In diesem Moment ist die Kündigung noch weit entfernt und doch beginnt genau hier die unsichtbare Bewerbung.
Das stille Ritual: Profil-Update statt Bewerbungsmail
Die unsichtbare Bewerbung hat ihre eigenen Rituale. Sie kommt ohne ‘Sehr geehrte Damen und Herren’ aus, ohne Dossier, ohne Motivationsschreiben. Sie arbeitet mit anderen Mitteln.
Da ist zuerst das Profilbild, seit Jahren dasselbe, etwas unscharf, zufällig entstanden. Eines Tages wird es ersetzt. Das neue Foto ist professioneller, klarer, entschiedener. Kurz darauf wird der Profiltext überarbeitet: Aus ‘Sachbearbeiter’ wird ‘Fachspezialist mit Erfahrung in …’. Projekte werden ergänzt, Weiterbildungen nachgetragen, Kompetenzen sortiert. Die berufliche Biografie wird aufgeräumt wie eine Wohnung, in der man noch nicht gekündigt hat, aber schon beginnt, Kisten im Kopf zu packen.
Dann verändern sich die digitalen Wege: Stellenanzeigen werden nicht nur einmal, sondern mehrmals angeklickt. Unternehmensprofile, die bisher nebensächlich waren, bekommen plötzlich Aufmerksamkeit. Beiträge zu Themen wie Führung, psychische Gesundheit, Teilzeit im Kader oder Fachkräftemangel werden nicht nur überflogen, sondern gelesen, geliked und fleissig kommentiert.
Es entstehen neue Kontakte: HR-Leitungen, Recruiter:innen, Teamleiter:innen von anderen Firmen. Ein unverbindliches ‘Lassen Sie uns vernetzen’ hier, ein ‘Wenn Sie einmal reden möchten, melden Sie sich’ dort. Nichts davon ist eine formale Bewerbung und doch ist alles bereits Teil einer stillen, sorgfältigen Vorbereitung. Die unsichtbare Bewerbung ist damit weniger ein Akt als ein Zustand: Man ist noch da, aber zugleich schon unterwegs.
Warum Geld selten der wahre Grund ist
Wenn dann irgendwann doch eine Kündigung auf dem Tisch landet, läuft in vielen Schweizer Betrieben das gewohnte Deutungsprogramm ab: ‘Da hat wohl jemand ein besseres Angebot bekommen.’ Geld ist greifbar, messbar und erklärt vieles ganz einfach. Es verdeckt, wie komplex die wirklichen Gründe oft sind. Wer ehrlich hinhört, hört andere Motive:
- zu viel Druck, zu wenig Personal, zu lange Tage,
- Führung, die nicht führt, sondern verwaltet oder kontrolliert,
- Entscheide, die von oben kommen, aber unten ausgebadet werden,
- das Gefühl, austauschbar zu sein, egal wie sehr man sich einsetzt,
- das schleichende Bewusstsein, dass die eigene Energie schneller sinkt als der Stapel der Aufgaben.
Geld ist oft der letzte, sichtbare Anlass, nicht der erste. Es legitimiert den Schritt, den man innerlich längst gegangen ist. Die eigentliche Kündigung findet dort statt, wo jemand merkt: Was diese Arbeit mir abverlangt und was sie mir zurückgibt, passt nicht mehr zusammen.
Die Blindstelle: Schweigen, das fälschlich wie Zustimmung klingt
Das Tragische ist: Die Arbeitgebenden hätten in vielen Fällen Zeit, zu reagieren. Zwischen der ersten inneren Distanz und dem tatsächlichen Austritt liegen Monate, manchmal Jahre. Dazwischen gäbe es Spielraum:
- für echte Gespräche, nicht nur standardisierte, seelenlose Mitarbeitergespräche,
- für klare Worte zu Belastung und Grenzen,
- für strukturelle Anpassungen, statt kosmetische, durchschaubare Massnahmen.
Doch oft passiert das Gegenteil. Die Person funktioniert weiter. Sie bringt Leistung, lächelt, sagt ‘alles gut’, wenn man flüchtig fragt. Und weil sie nach aussen stabil wirkt, wird sie als stabil verbucht. In der Personalstatistik sieht alles ordentlich aus. Die Fluktuation ist tief, die Welt scheinbar in Ordnung. Das laute Schweigen wirkt sedierend: Es wirkt wie Zufriedenheit, ist aber oft nichts anderes als Resignation oder Vorsicht. Man will sich nicht exponieren, nicht als ‘querulatorisch’ gelten, nicht diejenigen sein, die ‘immer etwas haben und meckern’.
Die unsichtbare Bewerbung ist damit auch ein Symptom einer Arbeitskultur, in der viele gelernt haben, dass es sicherer ist, zu gehen, als wirklich etwas zu sagen.
Was sich ändern würde, nähme man die unsichtbare Bewerbung ernst
Was würde passieren, wenn Unternehmen diese Realität nicht als seltenes Randphänomen, sondern als zentrale Herausforderung sähen? Sie müssten Loyalität neu denken. Nicht als selbstverständlich, sondern als Ergebnis. Als etwas, das entsteht, wenn Menschen erleben:
- dass ihre Zeit nicht bedenkenlos verschwendet wird,
- dass ihre Gesundheit nicht als Rohstoff behandelt wird,
- dass ihre Stimme nicht nur dann gefragt ist, wenn die Umfrage wieder fällig ist,
- dass sie entwickeln können, statt nur zu funktionieren.
Sie müssten aufhören, nur Fluktuationszahlen zu betrachten, und beginnen, die leisen Signale ernst zu nehmen: zunehmende Müdigkeit, Zynismus, sich häufende Kranktage, Mitarbeitende, die innerlich längst abgeschaltet haben oder sich im beruflichen Koma befinden. Und sie müssten akzeptieren, dass Menschen, die den Schritt zur unsichtbaren Bewerbung gehen, nicht illoyal sind, sondern konsequent. Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst, dort, wo Arbeitgebende es schon lange nicht mehr tun.
Die gefährliche Komfortlüge
Vielleicht ist der gefährlichste Satz in der Schweizer Arbeitswelt nicht ‘Wir finden keine Leute mehr’, sondern immer noch: ‘Bei uns ist die Fluktuation tief.’ Denn er legt sich wie eine weiche Decke über etwas, das längst in Bewegung ist. Er suggeriert Stabilität, wo es eigentlich vor allem Stillhalten gibt. Er lullt ein, wo Wachsamkeit bitter vonnöten wäre. Die unsichtbare Bewerbung zeigt uns zudem eine andere Realität: Menschen bleiben physisch, während sie geistig schon lange Abschied nehmen. Sie aktualisieren ihre Profile, pflegen Kontakte, prüfen Möglichkeiten und warten auf den Moment, an dem aus dem inneren ‘Vielleicht’ ein klares ‘Jetzt’ wird.
Die entscheidende Frage für Arbeitgebende ist deshalb nicht: ‘Wie verhindern wir Kündigungen?’ Sondern: ‘Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Menschen gar nicht erst das Bedürfnis entwickeln, unsichtbar zu kündigen?’ Wer sich dieser Frage stellt, verlässt die Komfortlüge und beginnt, wirklich Personalpolitik zu machen. Alle anderen werden weiterhin überrascht vor Kündigungen sitzen und sich einreden, es sei eben der Markt gewesen. Während im Hintergrund schon die nächsten Profilbilder hochgeladen werden.
Arbeitsrecht: Krankheit schützt nicht mehr in jedem Fall vor Kündigung.
5 Tipps: Arbeitgeberkündigungen fachlich korrekt und auf Augenhöhe aussprechen.